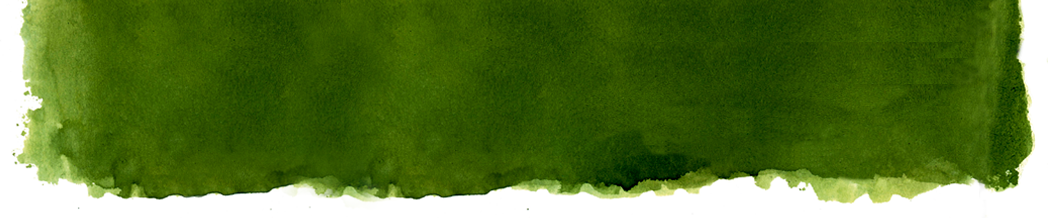Freitag
Günter Nowak
Was der Elfmeter für den Tormann, der Zauberberg oder vergleichbare Lungenheilanstalten für dezent hüstelnde oder sonst wie schwachbrüstige Literaten sind oder der Bloomsday für den irischen Whiskeyumsatz bedeutet, findet sein temporäres Pendent im Freitag, dem Doomsday aller Krachmann-Adepten: Der Ultimo, der Dies Irae, der Tag, an dem nur mehr die Hoffnung auf einen unerwarteten Herzinfarkt im besten – selbstverständlich gegenderten – Mannesalter bleibt und sich schiere Verzweiflung angesichts fünf leerer Seiten und einer in etwa vergleichbaren Anzahl an literarisch relevanter Hirnzellen um sich greift. Es ist letztmöglicher Abgabetermin für Krachmann und Ausreden zählen jetzt nicht mehr; Freitag vermeldet das Kalenderblatt und die Uhr tickt und tickt (im Falle von Digitaltechnik, dann natürlich symbolisch) …
Zeit ist bekanntlich relativ und ihr Verlauf nicht nur abhängig von Geschwindigkeit und Masse, sondern vor allem beobachterzentriert. Die Beobachtung beeinflusst immer das Beobachtete und die Messung das Messergebnis. Werner Heissenberg selbst war zwar noch jung an Jahren als er diese Unschärfe im Mikrobereich erkannte, aber niemand der die aktuelle menschliche Halbwertszeit erreicht oder bereits überschritten hat, wird eine deutliche Beschleunigung des Zeitablaufes bei zusätzlich forciertem Fortschritt des körperlichen Verfalls leugnen können. Alzheimer oder Demenz helfen bei der Verdrängung dieser Tatsache auch nur eingeschränkt; und da nur radikale Konstruktivisten wie Ernst von Glasersfeld generell die Existenz einer objektiven Realität und daher auch der Zeit bestreiten können, halten wir uns eher an Ludwig Boltzmann und seinen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und müssen daher in fatalistischer Weise die Auswirkungen der immer zunehmenden Entropie akzeptieren.
Die Folgen des daraus resultierenden unvermeidlichen Ursache-Wirkung-Dilemmas motivierten das englische Parlament im Jahr 1714 dazu einen der bis heute höchsten jemals ausgeschriebenen Forschungspreise für die Entwicklung eines präzisen Zeitmessgerätes zur Bestimmung des Längengrades auszuschreiben: Ein fatales Zusammenspiel von ungenauer Zeitmessung, dichtem Nebel und unnachgiebigen irischen Küstenfelsen hatte zuvor einen erheblichen Teil der englischen Kriegsflotte nach gewonnener Seeschlacht in Treibgut verwandelt. Trotz des immens hohen Preisgeldes und einer Vielzahl an Lösungsvorschlägen, dauerte es mehr als 40 Jahre bis im Jahr 1759 der Tischler John Harrison die Aufgabe lösen konnte und den ersten hinlänglich präzisen Chronometer konstruierte. James Cook bestätigte nach der Rückkehr von seiner zweiten Weltreise die Funktionsfähigkeit dieses „time keepers“ und so reihte sich dieser in eine menschheitslange Geschichte der Versuche der Zeitmessung und Zeiteinteilung: Denn spätestens seit den mesopotamischen Hochkulturen sind Ansätze zur numerischen Erfassung von Zeit nachweislich und seit damals untrennbar mit Zahlen verknüpft. Auch wenn unser heutiges Thema „Freitag“ lautet, gibt es keinen Freitag ohne Woche und keine Woche ohne die Zahl 7; und die Zahl 7 führt uns direkt in das antike Babylon: 7 war die Zahl der den Babyloniern bekannten Wandelsterne, später als Planeten erkannt, in denen sie eine Äußerung göttlicher Wesen zu erkennen glaubten. Vermutlich haben die Babylonier die mythische Interpretation der Zahl 7 im
4. Jahrtausend vor Chr. selbst von den Sumerern, die sieben böse Dämonen kannten, übernommen. Einer dieser sieben Wandelsterne wurde mit der Göttin Ishtar identifiziert, doch davon später.
Unser aktuelles Zeitempfinden basiert nicht nur auf chronometrischer Messgenauigkeit, sondern auch auf einem nahezu unüberschaubaren Spektrum an mythischer, historischer und kultureller Aufladung, die v.a. aus der antiken griechischen Numerologie sowie der Schöpfungsmythen der abrahamitischen Religionen und deren Vorläufern – wie der babylonischen Verquickung von Astronomie, Mathematik und Symbolik – in unseren Kulturkreis einflossen: Wichtig für unsere Thematik ist vor allem, dass es sich bei der griechischen Mathematik – insbesondere der Zahlenmystik nach Pythagoras – gleichwertig zum Rechnen an sich, um eine Religion und Geheimlehre handelte: Der Satz „Alles ist Zahl“ weist darauf hin, dass Mathematik nicht nur eine alleserklärende Methode, sondern selbst dieses Allumfassende sei. Mit Zahlen wurde im Altertum daher nicht nur gerechnet, sondern sie hatten auch eine symbolische und religiöse Bedeutung. Nicht nur im Aberglauben überlebte viele dieser Bedeutungen und Zuschreibungen bis in die Gegenwart.
Die 7-Tage-Woche war als ein Viertel einer Mondphase bereits in Babylonien und im Alten Reich Ägyptens gebräuchlich, und die Zahl 7 selbst blieb bis heute mythologisch vielfach aufgeladen: Die Schöpfungsgeschichte der monotheistischen Religionen übernahm sowohl Wochenlänge als auch Zahlenmystik und nennt bereits in den ältesten erhaltenen schriftlichen Tora- und damit auch Bibel-Überlieferungen im 5. Jahrhundert v. Chr. eine Sieben-Tage-Woche, wobei die ersten sechs Tage mit Nummern bezeichnet werden, der siebente Tag hingegen als „Ruhetag“ hervorgehoben ist. An dieser Stelle ist auf die Analogie zum Christentum zu verweisen: Sowohl moderne Zeitrechnung als auch christliche Religion entstehen aus einer Kombination jüdischen und griechischen Denkens und werden sich erst durch Macht und Infrastruktur des römischen Reichs der späten Kaiserzeit im Einflussbereich des Imperiums durchsetzen. Die Römer selbst verwendeten bis in die Spätantike einen Wochenrhythmus der sich nach den lokalen Markttagen richtete, der Markttag hieß „nundinae“, abgeleitet von „novem dies“, d.h. „neun Tage“. In Kalendern wurde dieser Wochenrhythmus durch die Buchstaben A bis H bezeichnet. Erst Konstantin d. Große gewährte im Jahr 313 in seiner Mailänder Vereinbarung nicht nur die Religionsfreiheit für das Christentum im römischen Reich, sondern führte 8 Jahre später, im Jahre 321 n. Chr., auch die siebentägige Woche im Römischen Reich ein.
Rund 1.700 Jahre danach ist zwar die Wochenlänge mit 7 Tagen weltweit durchgesetzt; mit einer seit 1975 geltenden ISO-Normung, wurde auch versucht die Reihenfolge der Wochentage weltweit zu regeln. Hier stößt die säkulare Welt, aber an ihre metaphysischen Grenzen: Da es kein Einverständnis dahingehend gibt, ob die Woche mit Sonntag oder Montag beginnt, ist der Freitag gemäß der Europäischen Norm EN 28601 und dem internationalen Standard ISO 8601 der fünfte Tag der Woche, nach jüdischer, christlicher und islamischer Zählung aber der sechste. Und auch die Zahl 6 eignet sich nicht nur zum Rechnen, sondern steht auch für eine Vielzahl an Symbolik: 6 ist nach Pythagoras eine „vollkommene Zahl“, weil die Summe der ersten Primzahlen 1 + 2 + 3 = 6 und 6 daher die Summe seiner echten Teiler ist. Darüber hinaus ergibt 2 x 3 = 6, wobei zwei nach Pythagoras die erste weibliche und drei die erste männliche Zahl ist. Nach dem Alten Testament schuf Gott Adam und Eva am 6. Tag – die Folgen dürften als bekannt vorausgesetzt werden –, nach Pythagoras ergibt die Multiplikation der Zahlensymbole von Mann =2 und Frau =3 die vollkommene Zahl 6. Wie tief die griechische Zahlenmystik das Christentum und damit die römische Welt sowie in Folge die daraus resultierenden Kulturen durchdrungen hat verdeutlicht die intensive Auseinandersetzung des Kirchenvaters Augustinus mit dieser vollkommenen Zahl, wobei er sich insbesondere mit der theologischen Frage auseinandersetzte, ob Gott die Sechszahl wegen ihrer Vollkommenheit wählte oder ihr erst durch seine Wahl diese Vollkommenheit verlieh. In der Karwoche kommt es konsequenterweise am 6. Wochentag, ab der 6. Stunde zum Höhepunkt der Passion Christi. Aber auch für die beiden anderen monotheistischen Religionen ist der Freitag als sechster Tag der Woche von besonderer Bedeutung: Im Islam gilt der Freitag nach dem Wort des Propheten als „der beste Tag vor dem Angesicht Gottes“, im Judentum, der Tag zur Vorbereitung des Sabbat, der mit der Abenddämmerung beginnt und der 6-eckige Davidsstern ist das Symbol des Judentums.
Das jüdische und christlich-griechische System des Durchzählens der Wochentage mit der damit verbundenen zahlenmythologischen Aufladung der einzelnen Wochentage trifft im römischen Reich auf Namen für Wochentage, die ursprünglich den 7 im mesopotamischen Kulturkreis bekannten Planetennamen und den diesen zugeordneten Göttern und Göttinnen entsprachen. Freitag war der Tag der Planetengöttin Ishtar, die unter anderem als Göttin des Krieges und des sexuellen Begehrens verehrt wurde. Mit der Übertragung dieser Tradition auf die römische Götterwelt wurde der sechste Wochentag als „dies Veneris“, also Tag der Liebesgöttin Venus bezeichnet. Eines ihrer bedeutendsten Heiligtümer im römischen Reich war der Venustempel in Erice im Westen Siziliens, an der Stelle errichtet, an der der Sage nach Änäas, Überlebender des Untergang Trojas, Sohn der griechischen Liebesgöttin Aphrodite und Gründervater Roms italienischen Boden betrat. Das Heiligtum erfreute sich – trotz überaus beschwerlichen Zugangs – ungeheurer Beliebtheit im gesamten römischen Reich, vermutlich nicht wegen seiner schönen Aussicht, sondern auf Grund der dort erlaubten Tempelprostitution. Diese altehrwürdige Tradition des kultischen Ge-
schlechtsverkehrs von Priesterinnen oder Tempeldienerinnen mit vermutlich tiefgläubigen und hochmotivierten Anhängern des Kults gab es vermutlich bereits in den alten Kulturen Indiens, Ägyptens, Lydiens, Numidien, insbesondere aber in Babylonien im Rahmen des Ishtar-Kults.
Es darf vermutet werden, dass die Tradition des Festtags der römischen Liebesgöttin bzw. deren babylonischer Vorgängerin, zwar noch mit dem alttestamentarischen Schöpfungsmythos von Adam und Eva am 6. Tag und dem pythagoreischen Konzepts der Multiplikation des männlichen und weiblichen Prinzips zu Vollkommenheit kompatibel war, keinesfalls aber mit dem Gedenktag der Kreuzigung Christi, insbesondere der katholischen Todessehnsucht und Sinnesfeindlichkeit. Darüber hinaus erinnerte der Tag der Venus als deren direkter Nachfahre sich noch Julius Cäsar betrachtete an den heidnischen Gründermythos Roms, der insbesondere durch die Petrustradition ersetzt werden sollte.
Zur Desavouierung des Venustages eignete sich eine römisch-
antike Tradition, die einen Unglückstag allgemein als „Dies Ater“ als „Schwarzen Tag“ bezeichnete. Der „schwarze Freitag“ galt daher bald in der christlichen Tradition und im daran anknüpfenden Aberglauben als ein besonderer Unglückstag, weil sich an einem Freitag, dem Karfreitag, die Passion und Kreuzigung Christi ereignet hatte. Die dahinterliegende Schizophrenie zeigt sich besonders in der englischen Sprache, in die der Begriff „Black Friday“ im 18. Jahrhundert als konkreter Kontrastbegriff zu „Good Friday“, wie der Karfreitag im Englischen in Hinblick auf das mit dem Tod Christi eingeleitete Erlösungswerk unter positivem Vorzeichen heißt, eingeführt wurde.
Der Freitag – insbesondere der Karfreitag – eignete sich aber nicht nur Abgrenzung zu den heidnisch-römischen Wurzeln des Christentums. Spätestens als der Kirchenvater Johannes Chrysostomos im vierten Jahrhundert die Juden als „zur Arbeit untauglich“ und nur „zur Verwendung als Schlachttiere“ geeignet bezeichnete wurde der religiöse Antisemitismus Teil der christlichen Tradition und äußerte sich in den nächsten Jahrhunderten in Form regelmäßiger Karfreitagsprogrome in jüdischen Gemeinden. Den psychologischen Hintergrund analysierten Horkheimer und Adorno angesichts der Perfektionierung dieses Programms im Holocaust als eine Form eines christlichen Ersatzopfers: „Den Juden schlagen sie ans Kreuz, endlos das Opfer wiederholend, an dessen Kraft sie nicht glauben können.“ Innerchristlich markierte die vom französischen König Philipp IV. befohlene Verhaftung aller Mitglieder des Templerordens in Paris und die darauffolgende Ausrottung so gut wie aller Ordensritter in ganz Europa das Paradebeispiel des Schwarzen Freitags. In beiden Fällen, sowohl der antijüdischen Progrome als auch der Zerschlagung des Templerordens, waren wirtschaftliche Motive, in Form von Raub des Eigentums der Opfer, zumindest gleichwertige Motive.
Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Ausdruck „Schwarzer Freitag“ inflationär für so gut wie jeden denkbaren Unglücksfall, der zufällig auf einen Freitag fiel verwendet. Am nachhaltigsten im kollektiven Bewusstsein ist heute aber wohl die Assoziationskette zwischen „Schwarzem Freitag“ und einem wirtschaftlich bedeutendem Unglückstag. Der ursprünglich angelsächsische Usus, wirtschaftlich bedeutsame Unglückstage als Black Friday zu bezeichnen, fand im Zusammenhang mit der Internationalisierung der Geldmärkte und des Pressewesens seit dem 19. Jahrhundert auch in anderen Ländern Verbreitung. Der erste belegbare wirtschaftliche Schwarzen Freitag, der von den Zeitgenossen auch so genannt wurde, war der 6. Dezember 1745: An diesem Tag erreichte die Nachricht London, dass der Kronprätendent Charles Edward Stuart, der mit zwei Schiffen in Schottland gelandet war und erfolgreich bis Derby vorgedrungen sei. In London führte daraufhin die Angst vor einer französischen Invasion und einer Restauration der Herrschaft der Stuarts zu einem vorübergehenden Kollaps des Bankwesens und Wirtschaftslebens. 120 Jahre später löste der Bankrott der Londoner Diskontbank Overend, Gurney and Co. Limited am Freitag, 11. Mai 1866 eine Panik in der Londoner City und eine Krise des britischen Finanzwesens aus. Ausgehend von der Londoner Times wurde der Begriff Schwarzer Freitag auch von der kontinentaleuropäischen Presse übernommen und fand durch den französischen Nationalökonomen Louis Wolowski auch Eingang in die Wirtschaftswissenschaften. Als Schwarze Freitage im deutschsprachigen Raum gelten der Wiener „Gründerkrach“ vom 9. Mai 1873 und der Kurssturz der Berliner Börse vom 13. Mai 1927, der sprichwörtliche Schwarze Freitag, war allerdings der Zusammenbruch der New Yorker Börse am 25. Oktober 1929, der die Weltwirtschaftskrise auslöste; und das obwohl die massiven Kursverluste eigentlich bereits am Vortag (Black Thursday) stattgefunden hatten und am Freitag sogar minimale Kursgewinne zu verzeichnen waren.
Dass sich der ökonomische Schwarze Freitag derartig massiv im kollektiven Gedächtnis festschreiben konnte ist ohne seine mythologischen und religiösen Wurzeln nicht erklärbar: Freitag ist und bleibt im christlichen Kulturkreis der Tag der größten Schuld; und es gibt keine Schuld ohne Opfer.
Die ersten menschheitsgeschichtlichen Opferhandlungen dienten der Besänftigung unerklärlicher, bedrohlicher und oftmals tödlicher Naturmächten, und konnten daher nur durch gleichermaßen schreckliche Opfer, nämlich Menschenopfer, erreicht werden. Nur solange er Schrecken von Opfer und Bedrohung muss gleichwertig ist, entsteht keine Schuld der Menschen gegenüber den Göttern. Bald aber verschiebt sich dieses Schuldverhältnis, weil Menschenopfer durch andere Opfergaben ersetzt werden; darüber hinaus verliert der Opfervorgang selbst auch durch permanente Wiederholung und Ritualisierung an Bedrohlichkeit, der Einsatz der Menschen gegenüber die Götter wird einseitig verringert: Menschenopfer, wurden durch Tieropfer ersetzt, schließlich durch symbolische Opfer, teilweise als Abbildungen der vormaligen lebenden Opfer, dann zunehmend in Form von Wertgegenständen, Edelmetall, schließlich Geld. Dieser Transfer ist nachvollziehen anhand des lateinischen Worts für Geld, „Pecunia“, wörtlich übersetzt „das Viehmäßige“; diese Wortbedeutung verweist nicht nur darauf, dass Geld Vieh als Tauschmittel im Handel ersetzte, sondern auch einen Übergang von traditionellen Tier- zu den modernen Metallopfern darstellte. Da diese neue Opferform nicht mehr wie bisher verbrannt oder verspeist oder sonst wie entsorgt wurde, häuften sich in den Tempeln ungeheure Schätze an. In tiefenpsychologischer Ebene entstand durch diese Ersatzopfer für Menschenopfer eine immer größer werdende Schuld der Menschen gegenüber ihren Göttern. Diese Schuld wird in Folge vervielfacht: Für die Priesterschaft wurde es zunehmend verführerisch, die in den Tempeln angehäuften Metall¬gaben nicht nur einfach herumliegen zu lassen. Daher führten sie die Tempelgaben einer neuen Form der Wiederverwertung durch Verleih gegen Gebühr zu. Damit erfanden die Priester den Zins und konnten ihn gegenüber ihren Kunden insofern auch problemlos rechtfertigen, dass sie mit diesen Geschäften das Eigentum der jeweiligen Gottheit antasteten und daher eine Gottesschuld bestehe. Die Priester vermehrten damit zwar die Tempelschätze, begingen mit dem Frevel das Eigentum Gottes quasi zu verleasen aber selbst ein Kapitalverbrechen. Es gibt einen deutlichen Hinweis auf diesen vormarxistischen, gleichzeitig sakralen und verbrecherischen Ursprung der Vermögensakkumulation: das Wort „Kapital“ verweist auf das lateinische Wort Caput, d.h. Kopf, aber auch „Haupt-Sache“, „etwas, was den Kopf betrifft, den Kopf wert ist, den Kopf kostet, ein todbringendes, todeswürdiges Verbrechen. Der moderne Kapitalbegriff erinnert so hintergründig an ein verdrängtes kapitales Sakrileg, als welches die Anhäufung von Edelmetall in ungemünzter und gemünzter Form einst begonnen hat und zur Säkularisierung einer nie vollständig einlösbaren menschlichen Schuld gegenüber den Göttern führte. Während so die Tempel zu Vorläufern der Banken mutierten, entwickelten sich die Tempelanlagen zu Märkten; eine der realitätsnahesten Beschreibungen dazu findet sich im Neuen Testament. Dass die ehrwürdige Tradition der Tempelprostitution dabei ebenfalls säkularisiert wurde, aber in und um die Tempel loziert blieb, kann hier nur vermutet werden.
Und hier treffen sich die Stränge. Die Ökonomie und ihre diversen Sekten haben mit ihrer Priesterschaft der Banker, den Laienpredigern der Investmentberater, ihren Franziskanern und Katharern des verantwortungsvollen und nachhaltigen Investments die Rolle der Religion übernommen und besetzt deren Positionen in ähnlicher Weise wie Kirchen auf vormals heidnischen Heiligtümern errichtet wurden. Man muss sich dabei vor Augen halten, dass Geld nicht aufgrund von Tausch, sondern aufgrund von Schuld durch einen Opfervorgang entstanden ist. Es entstammt ursächlich dem sakralen Bereich. Der Begriff „Geld“ verweist daher weniger auf „Gold“, sondern auf einer Wortbedeutung im Sinne des englischen Wortes „guilt“ also Schuld.
Der Tag der größtmöglichen Schuld aufgrund des größtmöglichen Opfers – des Gottesopfers – wird transformiert in den Tag der größtmöglichen ökonomischen Katastrophe, der christliche Karfreitag mutiert zum Schwarzen Freitag der Ökonomie. Der Gekreuzigte, der an diesem Freitag die Schuld der Menschheit auf sich nimmt, erlöst die christliche Menschheit zwar, nimmt sie aber gleichzeitig in eine neue Form der immerwährenden Schuldhaft. Es handelt sich letztendlich um die Einlösung der angewachsenen Schuld der Menschheit gegenüber ihrem Gott, weil sie sich von Menschenopfern freigekauft hat, durch den ungeheuerlichen Vorgangs des göttlichen Selbstopferungsvorgangs.
Die religiöse Katastrophe des Gottestodes wird im neuen Religionssystem Ökonomie durch eine quasi schicksalhafte Schuldentransferexplosion in Form des Schuldmediums Geld abgelöst. In analoger Weise wie der Festtag der antiken Liebesgöttinnen in den christlichen Gedenktag verwandelt und dabei deren tiefverwurzelte Symbolik und Mystik benutzt wurde, nutzt der Mythos Ökonomie den symbolbehafteten Freitag als Code für eine systemimmanente, regelmäßige Katastrophe, den Schwarzen Freitag.
Epilog
Die schicksalhaften Geschehnisse vor, während und nach der großen Opferleistungen – sowohl der christlichen als auch der ökonomischen Religion – mit dem Freitag, an dem es als Kulmination der vorhergehenden Ereignisse zu Katastrophe kommt, lassen sich mustergültig auch als Tragödien in ihrer klassisch antiken Form im Geiste eines Euripides erzählen: In Form einer Exposition, d.h. Einleitung, werden die handelnden Personen eingeführt und der dramatische Konflikt kündigt sich schicksalhaft an; eine Komplikation mit einer Handlungssteigerung verschärft die Situation. Nach der Peripetie, d.h. Umkehr der Glücksumstände des Helden erreicht die Handlung ihren Höhepunkt, den Klimax. Zwischengeschaltete aufschiebende, hinhaltende, verlangsamende Momente führen zu einer Phase der höchsten Spannung und bereiten die bevorstehende Katastrophe vor. Diese kulminiert im Tod des Helden bis hin zum Massensterben, kann aber auch der Übergang zur sittlichen Reinigung und Läuterung, der Katharsis führen. Es ist durchaus erhellend den Ablauf der christlichen Karwoche nach diesen dramaturgischen Kriterien der griechischen Tragödie mit seiner Katastrophe am Karfreitag zu lesen. Die antike griechische Wort „Tragödie“ bezeichnete ursprünglich einen „Bocksgesang“ bzw. „Gesang um den Bockspreis“ (griech. τραγωδία, tragodía). Beim Dionysoskult wurden Umzüge mit Maske und Bocksfell (griech. τράγος/tragos) zur Darstellung des Gottes selbst oder eines der ihn begleitenden Satyrn aufgeführt. Es ist reizvoll sich den unvermeidlichen nächsten Schwarzen Freitag mit Protagonisten im Bocksfell zu imaginieren.
Diese Analyse der dramatischen Struktur der antiken griechischen Tragödie findet sich als „Schema der fünf Akte“ in dem 1863 veröffentlichten Werk „Technik des Dramas“. Ihr Autor war Gustav FREYTAG.
Nachwort zum Epilog
Der Krachmann 2015 zum Thema „Freitag“ ist somit Geschichte: Einhellig wurde der begehrte Literaturpreis „Krachmann 2015“ von der diesjährigen Jury an das Autorenkollektiv Klein vergeben. Der Plot, in dem ein staunender Robinson auf seiner Insel unerwartet eine attraktive Blondine trifft und diese seine baff erstaunte Frage „Freitag? (!)“ mit der Gegenfrage „Warum solange warten?“ schlüssig und vielversprechend beantwortet, überzeugte nicht nur die Juroren, sondern auch das Fachpublikum.