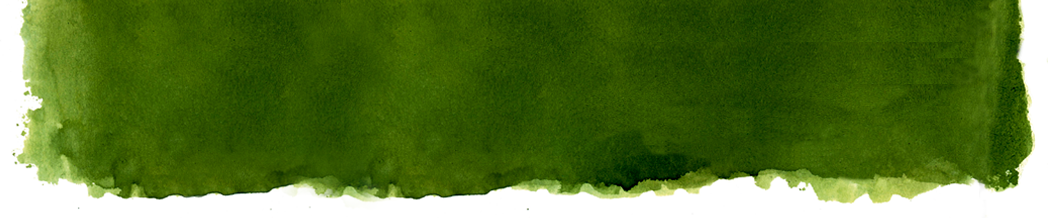FF
Stefan Loicht
Fidelio Freitag ist Buchhalter. Ein kleiner, grauer Mann mit einem bescheuerten Vornamen, beschäftigt, nein, nicht als Beamter oder in einem staatsnahem Betrieb, sondern in einem dieser alten privat- wirtschaftlichen Konzerne, in dem er gleich nach der Handelsschule anfing. Zum Bundesheer wäre er gern gegangen, aber: Babyboomer mit Plattfüßen. Man darf sich Fidelio nicht als unglücklich vorstellen, er hat im Keller auch keine Kammer des Schreckens, in der er Kinder quält oder autistisch Eisenbahn spielt. Er handelt nicht im Internet mit Nazi-Devotionalien, postet auch keine Verschwörungstheorien oder macht gar Ostküstenkreise, die Illuminaten und CERN für irgendwas verantwortlich. Er wählt auch nicht die FPÖ.
Er hat weder Frau noch Freundin, was ganz bestimmt nicht an seiner Mutter liegt, einer lebenslustigen, warmherzigen Frau mit Hippievergangenheit, deren einzige Schwäche eine gewisse Leidenschaft für Opern ist und die jederzeit ins Altersheim ziehen würde, um die gemeinsame Wohnung ihrem Sohn und einer Gefährtin, gerne auch einem Gefährten, zu überlassen. Auch über Vater Freitag gibt es nichts Negatives zu berichten, er war ein viel zu früh verstorbener Politikwissenschaftler mit ausgeprägten libertär-hedonistischen Zügen und einer links-emphatischen Weltsicht. Wer glaubt, die Eltern wären mit dem Sohn unzufrieden, geht fehl, sie akzeptierten ihn, so wie er war und ist und sie tut es auch heute noch. Es ist das gute Recht, jeder Generation gegen die vorgehende zu rebellieren, und vielleicht ist sein Leben sein Ausdruck davon.
Völlig ambitionslos geht er jeden Tag ins Büro, hält von acht bis vier die Bücher, eckt nirgends an, weigert sich, eine Meinung zu haben. Er sieht die MBAs kommen, die FHler gehen, die WU-Fuzzis scheitern und er sieht ihre Beförderungen. Er lässt sich umstrukturieren und prozessoptimieren, er ist im profit-Center und im Personalpool, er ist eine Kostenstelle und ein Kostenfaktor, er erträgt Incentives und Motivationsseminare und hat keine Topfpflanze. Er übergeht schweigend die kollegialen Geschichten von Kindern, Katzen und Kantinenessen und klaut keine Kulis. Seine Gräulichkeit, seine Gespensterhaftigkeit verleiht ihm die Aura des Unberührbaren, aber kein großer Plan verbirgt sich dahinter. Er ist kein kriminelles Superhirn wie weiland der blade Franz Lettmüller, der in einem ähnlichen Betrieb und eine Doppelexistenz führend ein paar hundert Millionen Schilling auf die Seite geräumt hat.
Er fährt mit der Straßenbahn in die Firma und geht zu Fuß nach Hause. Dort angekommen, kehrt er ein beim Wirten im Erdgeschoß des Wohnhauses und isst zu Abend. Er bestellt nicht immer das Gleiche, auch wird ihm nicht eine Portion des Tagesgerichts von zu Mittag aufgehoben. Er variiert, schweigend. Er sitzt immer alleine, aber seine Art, mit der er abweisend wirkt, ist keine unfreundliche. Er strahlt etwas aus, das seine Mitmenschen respektvoll Abstand nehmen lässt, dabei ist er bar jeder Arroganz oder Großkotzigkeit. Er macht auch keinen mieselsüchtigen oder verzweifelten Eindruck, geschweige denn riecht er streng. Und doch liegt in seinen Augen etwas verstörend Rätselhaftes.
Was also ist sein Geheimnis?
Es ist keines, das ihm bewusst ist. Es ist eines, das er nicht einmal ahnt. Es ist in ihm und doch weiß er nichts davon. Was er natürlich kennt, ist seine Tagträumerei, seine ausufernde Phantasie. Wenn er am Heimweg durch den Park die Kinder am Spielplatz betrachtet, die in den burgähnlichen Gebilden herumturnen, sieht er die Ritter Richard Löwenherz´ eine Festung stürmen. Betritt er das Wirts-haus, sind dort Leute, die ihre Ausreisepapiere studieren und er hört Menschen die Marseillese singen. Geht er an einer Baustelle vorbei, manifestiert sich ihm Pablo der Zerstörer, der irgendwo im spanischen Kolonialreich irgendwas oder irgendwen mit Verve zerlegt. In den Bürostunden, die andere vielleicht als freudlos bezeichnen würden, was für ihn keine Kategorie ist, segelt er über den stillen Ozean nach Tahiti, stets stummer Beobachter einer sich abzeichnenden Meuterei. In Demonstrationen, egal wofür oder gegen was, erkennt er erschreckend gering zivilisierte Bergvölker des ostmitteleuropäischen Raums, die mit Mistgabeln und Fackeln Chimären jagen. Ist Fußball oder ein Konzert, jedenfalls etwas, wo viele Menschen gleichzeitig in eine Richtung schauen und auf dasselbe auf die selbe Art reagieren, hört er eines Klumpfüßigen Rede im Sportpalast. Wird am Nachbartisch Schach gespielt, sind die Figuren Raketen und die Spieler Staatsoberhäupter. Der Wildplakatierer benagelt eine Kirchentür und das Folgetonhorn bringt Stadtmauern zum Einsturz. Der kaltstartende Türkendiesel speit Asche und Feuer statt Ruß und begräbt eine Kleinstadt.
So weit, so spinnert. Was Fidelio Freitag nun eben nicht weiß, ist, dass er mit seiner Phantasie unsere Welt erst erschafft. Die Welt ist alles, was sein Fall ist. Alles was jemals geschehen, ist Geburt seiner Ideen. Er ist der Schöpfer, er ist die Matrix. Nun mag es vielleicht wenig tröstlich erscheinen, ausschließlich aufgrund der Vorstellung eines Buchhalters zu existieren, trotzdem, schlimmer geht immer.
Er könnte ja auch Rechtsanwalt, Esoterikerin, Bankerin oder Fußpfleger sein. Aber wie ist es möglich, dass er, der Inbegriff des Indifferenten, der Demiurg sein kann?
Eine Erklärung deutet in die Richtung der Quantengravitation, nämlich zur Everettschen Viele-Welten-Theorie, die – die universelle Gültigkeit der Schrödingergleichung postulierend – besagt, dass es eine unendliche Zahl von Universen oder Welten gibt. Und in einer dieser Paralellwelten ist er der Allmächtige. Das ist natürlich Blödsinn, denn einerseits ist die Feststellung, dass es eine infinite Menge von Räumen und Zeiten gibt, der Beweis für das Nicht-Vorhandensein einer singulären Schöpfungsmacht: in einem Multiversum ist das komplexe Zusammenspiel der Lebensformen nicht Ergebnis eines Willensaktes, sondern nur der statistische Ausreißer. Andererseits ist die Sache ganz einfach: er ist nur eine Erfindung.
Ausgedacht von einem dilettierenden Amateurliteraten, der ver- zweifelt versucht, sich sein ereignisloses Angestelltenleben schön zu schreiben und der Langweiligkeit des Erwerbslebens einen wenn schon nicht tieferen, so doch wenigstens höheren Sinn zu geben. Wecker um fünf, Klo um halb sechs, Büro um dreiviertel sieben, Mittagspause um zwölf. Und so weiter. Immer dieselbe Routine, allenfalls durchbrochen von einer vermeintlichen Sensation, so wie wenn es frühmorgens im Jonas-Reindl einen angsoffenen Sandler am Ziguri haut oder einer von den Businesstrampeln in ihrem Kostümchen mit den gsteltzten Fick-mich-Schühchen sich in einer der unzähligen und komplett sinnlosen Jour Fixe-Besprechungen den total veganen Soja-Latte übers Silikon leert.
Dieser angeödete und zynische Mensch schafft sich also ein alter ego, dessen eintöniges Leben zwar zu dem seinen passt, aber im Vergleich eine deutlich sympathischere Figur ist, noch dazu ausgestattet mit sowas wie Superkräften. Was dieser Atheist – wohlgemerkt kein Agnostiker, denn er hadert oft mit sich, ob er dieses Leben verdient hat und welch rachsüchtige Macht daran schuld trägt – allerdings nicht versteht, ist, dass er sich mit jeder Zeile, die er schreibt und die im Übrigen außer durch ihn selbst ungelesen bleibt, weiter vom letzten Rest der Humanität entfernt. Alles gerade noch Gute in ihm überträgt er auf seinen Protagonisten, dies in der vergeblichen Hoffnung, erlöst zu werden. Seine Figur wird nicht lebendig sein und kein höh´res Wesen wird ihn retten.
Nix mit Auferstehung, Weiterleben, Seelenheil. Alles Mumpitz, Humbug, Aberglaube. Aber, ist es ein Paradoxon, wenn er in einer der ihn zerfressenden Maden reinkarniert wird?
Und das ist nur eine der Geschichten, die sich Metatron, Mohammed und der Heilige Geist restlos eingeraucht und sturzbetrunken am Lagerfeuer beim alljährlichen Campingausflug der übernatürlichen Sphäre in Wisconsin erzählen, um den dicken Buddha zu ärgern. Diese mehr-Ebenen-Sachen mit menschlichem Einschlag machen
ihn immer ganz fertig und die drei Dodeln haben wie üblich nichts besseres zu tun, als das asiatische Sensibelchen, das immer rührselig wird, wenn es zur Tragödie kommt und genug Schnaps im Spiel ist, zu sekkieren. „Mei Tschusch is ned deppat“ raunzt der feiste Philanthrop und furzt mit Inbrunst, so dass sich die Glaubensverkünder fast anspeiben müssen. „Ihr seids so gemein. Die Sterblichen sind auch nur Menschen. Lassts as halt amal in Ruh.“
Tiefes Seufzen.
Er zerknüllt einen weiteren Zettel vom Abreißblock, murmelt „so ein Schas“, nimmt einen tiefen Schluck und starrt versonnen ins Nichts. Eigentlich mag er ja diese Abende, an denen er mehr oder weniger friedlich und mit dem Hund an seiner Seite still an der Bar sitzt und versucht, sich Geschichten auszudenken und aufzuschreiben. Es fällt ihm halt zunehmend immer weniger ein, es dreht sich immer um dasselbe. Variationen in Witz und Stil, überraschende Wendungen und ganz allgemein Neues will sich nicht mehr so recht einstellen. Irgendwie war alles schon mal da. Ihm ist schon klar, dass auch seine verworfenen Entwürfe den Weg in die Welt finden werden, schließlich ist er ja nicht irgendwer. Aber zufrieden ist er damit nicht. Wann hat das angefangen? Seit wann hat er das Gefühl, dass der Typ, der ihm die Getränke reicht, sein einziger Freund ist? Er verliert sich in sentimentalen Betrachtungen alter Zeiten, als es besser schien und er der respektierte, sogar gefürchtete Meister
aller Klassen war. Jetzt produziert er nur mehr Scheiße und nicht nur er muss darunter leiden. Früher war er der unumstrittene Herr im Hause, nunmehr will er gar nicht mehr dort sein. Die verhärmten Weiber machen einem das Leben zur Hölle und die alten Kumpels sind Schatten ihrer selbst. Ja, er nimmt sich nicht aus. Faul, saturiert, verwöhnt ist er geworden, das Feuer brennt bestenfalls noch am Ende vom Tschick. Raus will ich hier, denkt er sich, wirft dem Hund einen Blick zu und in den treuen Augen sieht er Verständnis, fühlt aber gleichzeitig die Verantwortung, die ihn nicht fliehen lässt. Wo sollte er auch schon hin? Man kennt ihn schließlich überall und nur hier, an seinem einzigen Rückzugsort lassen ihn die ganzen Oaschkräuler, Heuchler, Paparazzi und das restliche Gesocks halbwegs in Ruhe. Dieser eine Abend in der Woche, an dem er sozusagen Ausgang hat, scheint ihm der letzte Rest der Herrlichkeit. Sehr traurig ist das und er auch.
Weit nach Mitternacht steht er schwankend auf, nimmt den Hund an die Leine, torkelt aus Bacchus´ Brunzhütte ins Freie und wie üblich macht Cerberus sein Gute-Nacht-Lackerl am Weltenbaum. „Da ist er wieder“, denkt sich Yggdrasil, „armer Zeus, so wie jeden Freitag.“