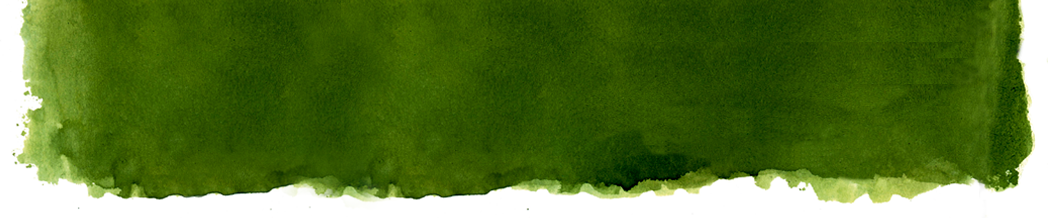Das wirklich wahre Leben von Mohammed
Das wirklich wahre Leben von Mohammed
von Stefan Loicht
Mekka, ca. im Jahre 571 nach Christus. Ein Wüstenkaff, eingeschlossen zwischen unbewachsenen Bergen, deswegen im Regenmonat überschwemmungsgefährdet, weil das Wasser nicht gehalten werden kann und es der überforderten Stadtverwaltung nicht gelingt, beim Wadi ein Inundationsgebiet zu realisieren. Die Idee eines Entlastungsgerinnes wurde vom zuständigen konservativen Stadtrat als „völlig blödsinnig, wirtschaftsfeindlich und sowieso nicht machbar“ abgetan. Das Rote Meer ist weit weg und die Karawanen kommen allenfalls vorbei, wenn sie sich verirrt haben. Das ist die ökonomische Basis der Mekkaner: zuerst falsche Wegangaben machen und sich dann für Aufenthalt und Ausweg bezahlen zu lassen. Nachdem der Schmäh seine Runde gemacht hat, haben sie sich was Neues einfallen lassen, nämlich ein Meteoritenrestl einzukasteln und zu behaupten, das sei irgendwas göttliches, deswegen Verehrung, Wallfahrt und so. Welche Göttlichkeit für ein Stück Stein verantwortlich wäre und was das überhaupt für eine theologische Grundlage hätte: wurscht. Die Pilger – das ist ja wirklich die dankbarste auszusackelnde Kundschaft ever – werden schon den entsprechenden Sinn finden, wenn man genug metaphysisches Brimborium drumherum treibt.
Dort wurde also Mohammed geboren, der sich bald als sensibles Kerlchen entpuppen sollte; sensibel in dem Sinne, als dass er intuitiv erfasste, was die grundsätzlich verbohrten Sandmänner so umtrieb. Für sein weiteres Wirken war entscheidend, als er – ziemlich pubertierend – mitbekam, dass sich die männliche Bevölkerung Mekkas ständig darüber beschwerte, dass die örtlich einheimischen Esel und Ziegen wirklich mühsam zu ficken wären. Die Weiber waren schirch wie tausend und eine Nacht, daher völlig zu Recht ganzkörperverhüllt (im lokalen Dialekt hieß diese Tracht „al-grus-al-barbamama“) und die grassierende sexuelle Frustration wurde zu einer existentiellen Bedrohung für das Funktionieren des Gemeinwesens. Jede Menge Wanderprediger, Säulenheilige und Höhleneremiten hatten sich mit dem Problem zwar schon beschäftigt, aber erst dem halbwüchsigen Mohammed ging das Petroleumlicht auf:
So schlug er vor, Länder zu erobern, in denen es flauschigere Viecher gäbe. Gesagt, getan, Nachbarstämme gemetzelt, Schafe gefunden, Erleichterung verschafft. Dass daraus irgendwann einmal ein Dogma gebastelt werden sollte, wonach mit Feuer, Schwert und Scherereien möglichst viele Weltgegenden auf der Suche nach dem ultimativen Nutzvieh abzugrasen seien, konnte ja keiner ahnen. Seis drum, so wurde er jedenfalls zum rising star unter den reichlich vorhandenen Verkündern von was auch immer, aber bis zum prima Propheten war es noch ein langer Weg.
Eigentlich war der Mohammed gar nicht erpicht darauf, sich in die Riege der religiösen Rauschzuständler einzureihen, aber wenn man einmal so ein Stigma hat, ist es nahezu unmöglich, es wieder loszuwerden, vor allem falls eine vom Notstand befreite und sohin entfesselte Jüngerschar nichts besseres zu tun hat, als auf die nächste fucking brilliant idea zu gieren. Jeder seiner Schritte war also unter dauernder Beobachtung. Sein Onkel, der ihn großzog, nachdem seine Eltern früh verstorben waren, gewahrte sich dieser eher heiklen Situation und schickte nach einem alten Bekannten, der Jugendleiter eines leidlich erfolgreichen Fußballvereines mit chronischen Nachwuchssorgen war. Vielleicht wäre ein längerer Aufenthalt im Internat der dortigen Akademie das richtige, um ein wenig Spannung rauszunehmen. Nach zwei Tagen war der kleine Mohi ziemlich zerzaust wieder da. Nicht nur, dass die anderen Buam ihn wegen seiner schmächtigen Statur ständig schmähten; auch das ganze Macho-Gehabe mit Dauerfetzerei („Ajde Brudi, schau, schau, Opfa, Oida!“) war ihm zuwider. Und dann auch noch die Verpflichtung, sich nach jedem Bewerbsspiel – egal wie es ausgehen sollte – in die Luft zu sprengen. Nein, der FC Dynamit Damaskus war nichts für ihn.
Überhaupt musste man ihm eine gewisse Feinsinnigkeit attestieren. Zart war er, mit spärlichem Bart- und sonstigem Haarwuchs – irgendwie ganz anders als die übrigen rüpelhaften Datteldodeln, in deren verfilzten Gesichtsmatratzen sich all die unzivilisierte Archaik stammesgesellschaftlicher Grob- und Borniertheit spiegelte. Dem Schönen war er zugetan, wobei, „schön“ schon ein wenig zu relativieren ist, angesichts der wortwörtlich wüsten Wohnverhältnisse. Wenn die Verwandten über die nächste Blutrache sinnierten oder aus Langeweile den nächst besten Andersgläubigen zerstückelten, bewunderte er die Würde des Sonnenuntergangs, erfand etwas, das er „Häkeln“ nannte oder nippte mit abgespreiztem Finger am Tee. Auch ein abweichendes Körperbewusstsein war ihm zu eigen; er wusch sich (in der Trockenzeit halt mit Sand), schnitt sich die Nägel und schnüffelte an den Essenzen des Orients, wenn wieder einmal ein Parfumkiste vom Kamel gefallen ist. Das alles blieb nicht unbemerkt und weil die Mekkaner mittlerweile im Verheeren, Plündern und Viehdiebstahl so erfolgreich waren, dass sie das andere erledigen lassen konnten, wurden sie immer träger und blader. Unzufrieden damit, da eine gewisse Gelenkigkeit für das zoologische Kopulieren vonnöten war, gingen sie also zum schlanken Mohammed, um ihn um Rat zu fragen. Simple Antwort: „Freßts ned wie die Schweine. Machts amal Pause.“ „Wie lange, oh Mohammed?“ „Ein Monat sollte reichen.“ So entstand der Ramadan. Dass das mit den Schweinen (der Protokollführer hat beim „wie“ grad furchtbar rülpsen müssen und es deswegen verpasst) nur das erste von vielen Missverständnissen war, ist evident.
In dieser Phase war seine segensreiche Tätigkeit also insgesamt eher auf salomonische Wahrsprüche und Konsultationen aller Art angelegt, ähnlich wie bei einem Rabbi in einer der beiden benachbarten Buchreligionen, dem von Mohammed insgeheim hoch geachteten Judentum, dabei seine Bewunderung vor allem einer Sitte galt, nämlich jener, die Manneszier mittels eines kleines chirurgischen Eingriffs aerodynamischer zu gestalten. Das gefiel ihm einfach und praktisch war es auch, bei dem ganzen Sand. Da hat es dann weniger geknurschpelt. Beobachten konnte er das bei seinem Lieblingscousin Ali, der bei den jüdischen Banu n-Nadir in Yathrib aufgewachsen war. Überhaupt hatte er zum Ali eine irgendwie ganz besondere Beziehung, die von inniger Vertrautheit geprägt war. Die beiden pickten immer beieinander, und wenn das nicht ging, haben sie sich ohne Unterlass Selfies auf Whatsapp geschickt, sie meist posierend im Privaten zeigend und stets garniert mit gereimten und durchaus anzüglichen Sinnsprüchen, sogenannten Suren. Bis der Ali eines Tages mit dem hübschen Hassan für ein paar Tage zelten ging. „Elender Surensohn, verfluchte Surenkinder!“, rief der Mohammed und noch ein paar Verwünschungen, grummelte „ Surenbock, nichtswürdiger“ und löschte den kompletten Ali-Chat samt allen Fotos. Stinksauer schwor er sich, nie wieder Aufnahmen von sich zu machen und sprach ein ewiggültiges Bilderverbot aus.
Zwischenmenschliche Macheloikes sind das eine, gute Ratschläge erteilen und irgendwann Prophezeiungen von sich geben das andere, aber auch weise Männer sollten sich um ihren Lebensunterhalt sorgen und so beschloss Mohammed, der Tradition seiner Händler- und Unternehmerfamilie zu folgen und ein Geschäft zu eröffnen. Seine Idee war ja grundsätzlich nicht schlecht, es schwebte ihm ein Laden vor, in den er selbst gern als Kunden gehen würde. Nun war die Zeit vielleicht nicht nicht ganz reif für Soja-Latte und veganes take-away; auch die Strickecke war vermutlich ihrer Zeit voraus. Das größere Problem war jedoch, dass er einen anderen Cousin, und zwar Osman mit dem Sprachfehler zur Anmeldung auf die Gewerbebehörde schickte und es dem Schmock von Beamten völlig wurscht war, was der Osman da daherbrabbelte. Jetzt war schon die Lage von dem Laden nicht eins A (zwischen der Gerberei und dem Waffenhändler), aber dass aus „Zum Fröhlichen Falafisten“ „Zum Tödlichen Salafisten“ werden sollte, war sowohl für den weiteren Geschichtsverlauf als auch für die vom Warenangebot einigermaßen enttäuschte Kundschaft von gewisser Wirkmächtigkeit.
Auch wenn der Mohammed eher von der gemütlichen Sorte und dazu ein bisschen feinnervig war, so muss man doch erkennen, dass es raue Zeiten waren und Gewalt nicht unbedingt verfemt, im Gegenteil, ohne Haudrauf-Attitude hatte es sogar ein Geistesmensch ungemein schwer. Nicht nur, dass die Imbissbude so gar nicht ging, auch unter Warenschwund hatte sie zu leiden und als er den dafür verantwortlichen Gemüsedieb auch noch in flagranti ertappte, wurde diesem ohne Federlesens vom Geschäftsinhaber die zugreifende Hand mit dem Melanzanimesser abgehackt. „Ein Zeichen, ein Zeichen!“ jubelte das primitive Volk, denn bis dato wurden Gesetzesbrecher einfach nur umgebracht; mit dieser neuen Vorgehensweise konnte man die Delinquenten weiter verwenden, zum Beispiel sie anstatt der Esel die Mühlen betreiben zu lassen, um die freigewordenen Grautiere für eh schon wissen zu verwenden, wenn die Schafe ausgeleiert waren. Neuer Status des Propheten in spe: Legislative und Exekutive in einem.
Schön langsam war ihm der ganze Rummel nicht mehr geheuer und auch das Blutbad in seiner ansonsten fleischlosen Küche hat ihm ganz schön zugesetzt, worauf hin er sich an diesem Abend ganz fürchterlich einen reingebrannt hat, Wein und Schnaps durcheinander soff und sich dazu 13 Pfeifen, gestopft mit nizaritischen Zauberkräutern und Weihrauch genehmigte. Mit so einem Fetzen muss man normalerweise Visionen haben, wovon auch der das ziemlich nach Eingebung und Ausdünstung stinkende Gemach betretende Postler Ibrahim – in ganz Mekka als geschwätziger Gerüchteverbreiter bekannt – überzeugt war. Wie er also dem eher verrenkt daliegenden Auguren die Morgenzeitung geben wollte, dieser aber nur in ungewohnter Zunge und belämmert „Nie wieder Alkohol“ stöhnte, machte der Briefträger sofort kehrt, um den nach Richtlinien dürstenden Stadtbewohnern die neueste Offenbarung des verehrten Mohammed zu überbringen. Am Abend halbwegs ernüchtert, wurde ihm klar, was er da angerichtet hatte und entschied sich, fortan nur mehr im Geheimen zu saufen und im übrigen die gewonnene Macht zu seinem Vergnügen einzusetzen.
Als erstes nahm er sich einen aus Jugoslawien verschleppten und schriftkundigen Sklaven (dessen Unterhalt natürlich auf Gemeindekosten lief), der fürderhin alle seine Auslassungen aufzeichnen sollte, damit er die Kontrolle behalten würde. Wann immer sich Mohammed zu einer aus seiner Sicht relevanten Äußerung hinreißen ließ, sagte er dann nur: „Goran, schreib das auf!“ Bei auftauchenden Fragen oder strittigen Interpretationen: „Schau beim Goran nach.“ oder „Frag das den Goran.“ Weil im Arabischen ein „g“ ein „dsch“ ist, der Schreiber aber nun einmal nicht „Dschoran“ hieß, kann man sich die Konsequenzen denken. Als nächstes war die Konsolidierung der Familienverhältnisse an der Reihe. Wie jeder gute Bürger hatte er die eine oder andere Ehefrau, alle natürlich potthässlich und ein Eheleben nur auf dem Papier. Wo andere mit geschlossenen Augen sich um den Nachwuchs kümmerten und sonst im Stall zugange waren, versagte er sich auch dieses, Ali sei Dank. Nun aber nahm er die achtjährige Aisha zur Frau, erstens um sich noch mehr Respektabilität zu verschaffen und zweitens hatte er mit ihr endlich jemanden, mit dem er Prinzessinnenverkleiden spielen konnte.
Ab jetzt war „schau ma, was einegeht“ die Devise. Königlich amüsiert hat er sich, als er aufgerufen wurde, den erbitterten Streit zwischen zwei Gruppen zu schlichten, die sich einfach nicht einigen konnten, welches Lied zur Eröffnung des alljährlichen Jahrmarktes auf der Festdüne gespielt werden sollte: „Da kummt die Sunn“ oder „Schifoan“. Dämonisch kichernd verfügte Mohammed, dass keines von beiden zum Einsatz kommen und stattdessen „I am from Arabia“ erklingen sollte. Im Wissen, dass keine von beiden Parteien zufrieden sein, aber sich dennoch beugen würden, suhlte er sich im faulen Kompromiss und genoss seine Macht über die verfeindeten Lager. Leider überdauerte die Lösung nicht und Sunniten und Schiiten liegen sich nach wie vor in den Haaren. Bei was anderem ähnlich blöden aber war er nachhaltig erfolgreicher. Er wollte nämlich bei seinem Schrebergartenhäuschen am Stadtrand einen Pool, aber bei den örtlichen Bodenverhältnissen ein Loch zu graben war wirklich unzumutbar. Also behauptete er, die Felsformation an der Grundstücksgrenze sei der Teufel, der umgehend gesteinigt werden müsste. Hallo? Abgesehen davon, dass die ganze Aktion grundsätzlich so sinnvoll ist, wie den Rasen mit Gras zu bewerfen, um ihn zu mähen, wie dämlich muss man sein, um den Schmafu zu glauben? Das Böse schlechthin, der Scheitan, ist ein Stanahaufen! Vollidioten. Die machen das heute noch. Na egal, der Effekt war, dass – weil man ja die Steine mit der Hand werfen muss, damit das einen „Sinn“ hat und daher nicht zu weit weg stehen darf – die Grube für Mohammeds King-Size-Jacuzzi entstand.
Zugegeben, ein wenig wunderlich war der Mohammed schon, aber er wusste das Beste daraus zu machen. Zum Beispiel hat er einen ihm zwar nicht ganz freiwillig, aber dennoch zu Diensten stehenden Jüngling in den höchsten Turm der Stadt sperren lassen. Zu mehr oder weniger regelmäßigen Zeiten wohnte er ihm fünfmal am Tag bei, und damit es auch jeder mitbekam und die Leistungen des Propheten bestaunen konnte, verfügte er, dass immer genau dann ein Gebet abzuhalten sei. Die für die Bevölkerung animalisch vertraut klingenden Geräusche seines Lustempfindens gaben das Signal, mit dem Gottesdienst loszulegen und diese schöne Tradition ist dankenswerterweise beibehalten worden, auch wenn man die Wurzeln dieses Brauchs nicht mehr so gern erklärt. Außer der einen Episode, wo es ihm nicht gelang, eines ausnehmend feschen und ungeheuer behenden Tänzers habhaft zu werden (nächtelang konnte man ihn klagen hören: „I derwisch eam ned!“), konnte also er im Prinzip schalten und walten, wie er wollte, doch eines Tages ging er dann schließlich zu weit. Weil ihm das ganze Getue, Geprotze und Gehupe schwer auf die Nerven ging, verbot er aus einer Laune heraus kurzerhand BMWs, Iphones und Adidas als nicht halal. Wui. So fühlt sich also Revolution an.
Um die Sache nicht weiter eskalieren zu lassen und damit ein wenig Ruhe einkehren möge, zog er sich zur Kontemplation in die Wüsteneinsamkeit zurück. Dort hatte er dann tatsächlich die Erleuchtung, nachdem ihn der Blitz beim Scheißen traf und total manisch fing er an, zu komponieren und librettieren und ein Monat später begann sein weltweiter triumphaler Siegeszug – der Rest ist Geschichte. Niemals wieder war etwas so begeistert aufgenommen worden wie die Uraufführung seines Musicals „Ich war noch niemals in Medina“. Um Mohammeds Anhängern die Aussicht auf das Paradies zu öffnen, genügte alleine schon, dass die Chorus Line aus 72 – wohlgemerkt importierten – Jungfrauen bestand.