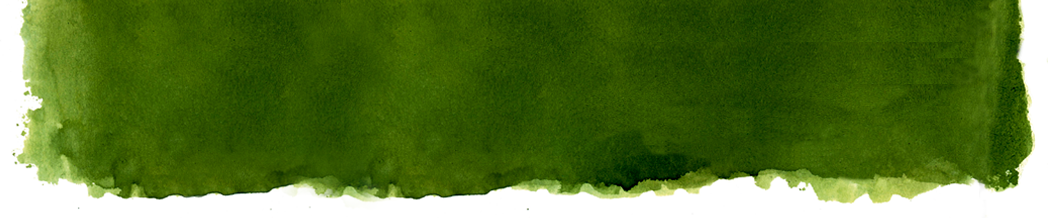Krieg ist nicht gut und Frieden schon
Krieg ist nicht gut und Frieden schon
von Martin Strecha-Derkics
Immer dann, wenn ich eine Rechtfertigung dafür brauche, warum ich geworden bin, wer ich bin oder ich bei meinem Gegenüber schlicht Mitleid erregen möchte, gebe ich freimütig preis, wie ich aufgewachsen bin: Örtlich in Wien Simmering. Genauer in Kaiserebersdorf. Wenn Sie Simmering nicht kennen, bleiben Sie dabei. Es ist kein Zufall, dass es von Simmering keine Ansichtskarten gibt. Wenn aber Vorurteilsfanatiker meinen, Simmering sei der Arsch der Welt, werfe ich ihnen in aller gebotenen Schärfe entgegen: Aber Kaiserebersdorf ist der Nabel vom Arsch der Welt! Kaiserebersdorf muss man sich vorstellen wie New York, London oder meinetwegen Paris. Spannend genug, um für ein Wochenende dort hinzufliegen, aber nichts, um für immer dort zu leben. Dennoch sind mein Bruder und ich aus tiefer politischer Überzeugung unserer Eltern im dortigen Gemeindebau aufgewachsen. Unsere Eltern waren nämlich Orthodoxe. Orthodoxe Sozialisten. Die Familiendoktrin hieß Alle Menschen sind gleich. Mutter lebte das auch vor. Sie war wirklich immer gleich. Angezogen in Hippie-Uniform, das Haar bis zum Gesäß und sogar die Achselhaare hennarot gefärbt. Sie wirkte stets dezent eingeraucht, auch wenn sie nichts gekifft hatte. Vater hingegen brauchte keine Drogen zu nehmen. Man nannte dieses Phänomen damals naturwaach. Optisch glich er allen damaligen philomarxistischen Existenzialisten in einer Mischung aus Karl Marx und Karl Dall. Ein riesiger, rauschender Bart, der jeden Hipster-Salafisten vor Neid explodieren ließe, zierte sein Antlitz. Mein Bruder und ich wussten sehr lange nicht, wie das Gesicht unseres Vaters aussieht. Wissen es erst seit kurzem, wo er sich den Bart abrasieren musste, da man in Österreich das Vermummungsverbot eingeführt hat. Ebenso waren wir sehr erstaunt über unsere Entdeckung, dass er in Wahrheit Brillenträger ist. Zusammenfassend kann man also sagen, unsere Eltern hatten einen Charme wie Wolfgang Sobotka und waren dafür sexy wie Wolfgang Sobotka.
Dabei stammten beide aus reichem Hause. Mutter hatte eine Villa im 17. Bezirk geerbt und der Vater die Konservenfabrik seiner Eltern, was ihn urplötzlich zum Kapitalisten machte. Das war natürlich ein Rostfleck auf dem Schwert eines echten Sozialisten. Und so zettelte er konsequenter Weise einen Aufstand unter seinen Arbeiterinnen an. Gegen sich selbst. Woraufhin unsere Familie flüchten musste. Mutter hatte Gott sei Dank noch ihre Villa versilbert und wir zogen in den Gemeindebau. Es war anfangs ein Schock. Vom Cottage-Viertel mit 1500m² Wohnfläche, eigener Köchin und einem Anwesen, wo sich Fuchs und Hase Gutenacht sagen, sich plötzlich in einer Gegend mit 1500 Möbelix Einbauküchen eingepfercht in 1500 Wohnklos mit Vierteltelephon zu finden, wo sich die alleinerziehende Billa-Kassierin und der kleine Mann von der Straße allabendlich ein zärtliches Geh scheißen! zuriefen.
Ein Gemeindebau ist in seiner Anmut eine realsozialistische, kubistische Meisterleistung. Wohin das Auge schaut, Zimmer mit Ausblick auf Zimmer mit Ausblick. Dafür alles gleich. Jede Stiege, jedes Haus, jede Wohnung. Namensschilder etwa existierten nicht dafür, dass einen der Briefträger gefunden hätte (denn dieser hätte sich spätestens nach dem zweiten Zungenkuss vom Rottweiler der Nachbarin ohnehin nicht mehr ins Stiegenhaus getraut), sondern diese Namensschilder waren dazu da, um selbst die eigene Wohnung wieder zu finden. Mein Bruder und ich hatten lange geglaubt, dass unser fehlendes Namensschild der Grund war, warum der Vater regelmäßig nicht unsere Wohnungstür, sondern jene der allein stehenden Nachbarin nahm.
Generell muss gesagt werden, dass wir eine sehr schwierige Kindheit hatten. So durften wir Kinder zum Beispiel nicht lachen. Mutter meinte, das wäre nicht fair angesichts des Elends auf der Welt. Hunger, Not, Kriege, Nicaragua, Äthiopien, Kaiserebersdorf, das alles wäre kein Grund zu lachen. Das hatte aber auch den Vorteil, dass wir zwei Buben enorm gut weinen konnten. Wir saßen oft Stunden im Kinderzimmer und weinten. Absichtlich, laut und lang. Bis Mutter endlich zu uns kam und fragte, was denn los wäre. Wir antworteten, dass wir so traurig wären wegen der armen Kinder unter Pinochet. Da lobte uns die Mutter dann, war stolz und gab uns jedem ein Jolly-Eis dafür. Noch heute kann ich an keinem Eisgeschäft vorbeigehen, ohne eine Träne zu vergießen. Wir durften eigentlich auch nicht fernsehen. Außer wenn Dokumentationen liefen. Diese mussten wir dann schauen. Einmal war es eine Doku über Lateinamerika. Und wir erfuhren, dass bei jedem Atemzug, den wir hier im reichen Westen machten, in Lateinamerika ein armes Kind starb. Das machte uns sehr betroffen. Da wollten wir helfen und hielten schließlich eineinhalb Minuten lang die Luft an und retteten damit einer ganzen Kinderbrigade aus Bolivien das Leben.
Hin und wieder bekamen wir auch Besuch von der einzigen kommunistischen Kampf-Kommune aus dem Gemeindebau gegenüber. Das Interessante für uns war dabei, dass diese Leute, die da gekommen sind, alle haargenau so aussahen wie unsere Eltern. Alle Mütter trugen sehr neckisch bis über die Knie das ultimative Musthave der Hippie-Generation, den sogenannten Hängebusen. Denn es war verpönt, BHs zu tragen. Man war schließlich antiautoritär und das galt auch für die Schwerkraft. Die Väter trugen selbstverständlich Bart. Wenn drei solcher
Männer bei uns in der Wohnung waren, wussten wir oft gar nicht mehr, wer davon unser Vater war. Mutter manchmal auch nicht.
Später, schon in der Schule, bekamen wir noch ein Geschwisterchen. Eine Schwester. Wegen der Frauenquote. Sie hatte es nicht leicht bei uns, war immer ein bisschen anders. Sie interessierte sich für andere Länder, für exotische Kulturen. Als sie zarte Sechzehn war, träumte sie von einem Abenteuer mit einem Schwarzen. Heute ist sie mit ihm sogar verheiratet: mit dem ÖVP-Bezirkssprecher von Gänserndorf.
Äußerst ungern denke ich noch an die internationalistischen Kochkünste unserer Mutter. Während alle anderen Kinder ortsüblich ab dem zweiten Lebensjahr mit Vollkost aus Schweinsbraten, Erdäpfelsalat und Schnitzel gefüttert wurden, gab es bei uns kommunistisch korrekte Kollektivkost: Russisches Ei und serbische Bohnensuppe. Hin und wieder ergänzt durch das Minderheitenmenü, dem Roma- und Sintifilet. Das Zigeunerschnitzel mochte ich aber auch nicht. Selbst unserem Vater war das irgendwann zu viel und in Folge war er einer der allerersten, der komplett auf glutenfreie Ernährung Ernährung umstellte. Von einem Tag auf den anderen ernährte er sich nur noch von Bier, Schnaps und Wein. Er war dann jeden Abend komplett weltoffen und gleichzeitig vollkommen zu. Wir durften ihn in solchen Momenten Väterchen Prost nennen. Er selbst bezeichnete seine Methode Think global, drink local.
Als äußerst trostlos erinnere ich mich an jede Weihnacht. Während es überall Tradiotionelles gab, wie den Festtagsbraten, Geschenke, Vanillekipferl oder einen Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt, hatten wir nicht einmal einen Christbaum. Es war bei uns nämlich Sitte, dass unsere Mutter zu Weihnachten unsere Bruno-Kreisky-Büste schlichtweg zum Christbaum erklärte. Freilich hatte jeder Raum in unserer Wohnung einen eigenen Namen. Das schmale Vorzimmer hieß zum Beispiel Karl-Marx-Allee, das Schlafzimmer der Eltern Karl-Liebknecht-Halle, die Küche nannten wir Margarete-Schütte-Lihotzky, usw. Jener Ort, wo in jeder anderen Wohnung des Gemeindebaus die Couch mit dem Rapid-Polster platziert war, zu Weihnachten aber der Christbaum und bei uns die Bruno-Kreisky-Büste stand, hieß in unserer Wohnung Roter Platz. Und dort mussten wir dann alle Aufstellung beziehen. Da die Mutter, die dem Bruno Kreisky das Lametta über die Brille hängte, da Väterchen Prost, da wir Buben, die noch ein Weihnachtsgedicht aufsagen mussten:
Friedrich Engels komm zu mir
Mach ein rotes Kind aus mir
Krieg ist nicht gut und Frieden schon
Viva la Revolution.
Die Eltern rauchten sich dann noch etwas an, denn Opium fürs Volk taugte ihnen an der Religion schon und mein Bruder und ich weinten bitterlich. Denn das war die Chance, dass wir am Heiligen Abend doch noch etwas geschenkt bekamen: ein Jolly-Eis.