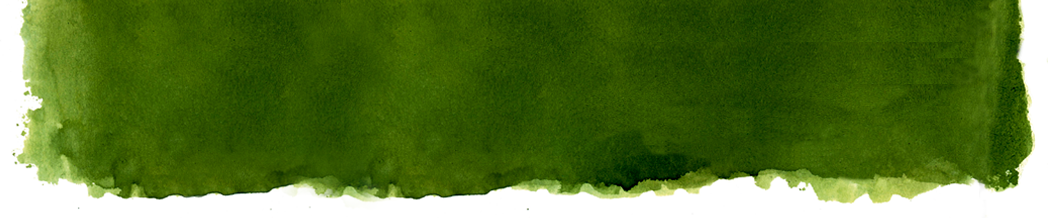Krachmann – Wettbewerb 2005
Wurst Stefan
Der erst im Alter von 57 Jahren und interessanterweise als Mitbegründer einer Boyband bekannt gewordene Komponist, der auch als Autor des Librettos zeichnet, verweigert seit der vorvergangenen Dienstag stattgehabten Uraufführung seines Opernerstlings jede öffentliche Stellungnahme, sodass man hinsichtlich seiner Reaktion auf die von der Kritik einhellig als freundlich zu bezeichnende Aufnahme seines Werks auf Spekulationen angewiesen ist.
Insbesondere bleibt unklar, ob und inwieweit der Meister sein Verbot, das Werk auch dem Publikum zugänglich zu machen, nunmehr eventuell aufzuheben oder doch wenigstens zu lockern bereit sein könnte. Der Kompromissvorschlag, mit dem der beliebte Universalkünstler im vielbeachteten Interview aufhorchen ließ, das er zwei Wochen vor der Uraufführung dem Mitteilungsblatt der Vereinigung der Deutschen Adelsverbände gegeben hat, wonach er sich die Zulassung von Publikum unter der Bedingung vorstellen könne, dass es sich bei den – wie er sich ausdrückte – „Zuhörern“ ausschließlich um erwiesenermaßen stocktaube und neugeborene Chinchilla-Männchen handle, wurde vom Auftraggeber des Werks, Opernhofdirektor Öaoam Niederträchter, letztlich nach erbitterten Protesten der Vorsitzenden des Gemeinnützigen Frauenvereines für gefallene Mädchen Uetikon am See e. V. verworfen. Dies umso mehr, als der Autor für den Fall der publikumsöffentlichen Aufführung auch die Verwendung des eigens für dieses Werk von ihm erfundenen (und gemeinsam mit dem weltbekannten Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle weiterentwickelten) Musikinstruments – der sog. Gemshorn-Mofette – untersagt hatte. Bei der Gemshorn-Mofette handelt es sich um eine Tischorgel mit Zungenpfeifen, die vermittels aus Quapp-Hörnern hergestellten Gefäßflöten gespielt werden, was – für sich betrachtet – selbstverständlich noch keine Besonderheit wäre. Die unverwechselbare Klangfarbe der Gemshorn-Mofette verdankt sich vielmehr zwei durchaus bedeutenden und darum bemerkenswerten Umständen: Zum einen wird das Instrument nicht an der freien Luft gespielt, sondern versenkt in einen aus dem Dreiländereck Sachsen-Bayern-Böhmen stammenden und auf 37,2° C erwärmten mobilen Wandersumpf, wodurch die vom sozusagen „unterirdisch“ wirkenden Virtuosen erzeugten Blubbergeräusche, zumal systembedingt jeder Kontakt mit dem Dirigenten und dem übrigen Orchester fehlt, mit einer schlechterdings obszönen, ja nach gerade ans Unanständige gemahnenden Rücksichtslosigkeit emporzusteigen pflegen. Zum anderen aber, und dies macht das Instrument abseits aller billigen Effekthascherei zu einer musikalischen Sensation, sind die Vorkommen des Quapps (ebenso wie des Röhricht-Quapps), dessen Hörner ja für die Herstellung der Gefäßflöten benötigt werden, streng auf bislang noch unentdeckte Kontinente beschränkt.
Unter diesen Umständen – nämlich wenn Publikum, dann erstens nur taube Chinchilla-Säuglinge und zweitens Verzicht auf die Gemshorn-Mofette, war daher eine Alternative zum Ausschluss des Publikums undenkbar, zumal ja die – im Übrigen selbstverständliche – Atonalität des Werks vom Komponisten nicht im hergebrachten Sinn verstanden wurde, sondern vielmehr bei der Orchestrierung im Verzicht auf sämtliche Musikinstrumente, eben bis auf die Gemshorn-Mofette, Ausdruck fand.
Allerdings ging der neue „Star der Taktlosigkeit“ , wie der Komponist von weiten Teilen der Fachpresse bereits genannt wird, nicht so weit, seine Bewunderer und die mächtigen Orchestergewerkschaften gänzlich vor den Kopf zu stoßen, was ihm bereits – wie könnte es anders sein – vielfach als Zugeständnis an den Massengeschmack des – wenngleich nicht zugelassenen – Opernpublikums angelastet wird: So verfügte der Meister in seinen diesbezüglich unmissverständlichen Anweisungen nicht nur, dass während der gesamten Aufführung alle Mitglieder eines großen Opernorchesters – inklusive Panflöte und Diskantgeige – im Orchestergraben anwesend – wenngleich still wie die Mucksmäuschen – zu sein haben, sondern auch, dass während der ungezählten von ihm anberaumten Orchesterproben die Mitglieder des Orchesters, wenngleich ohne Noten und ausschließlich auf von ihnen nicht beherrschten Instrumenten, die ihnen zugedachten (wenngleich nur hypothetischen, weil nach Beendigung der Proben ja nie wieder gespielten) Parts gewissenhaft einzustudieren hatten. Die Beliebtheit des Komponisten bei vielen Orchestermitgliedern soll sich zum Teil daraus erklären, dass es bei den Proben zu außerordentlich überstundenintensiven Dienstplanüberschreitungen gekommen ist, die überwiegend auf den Umstand zurückgeführt werden, dass der Komponist einzig dem Dirigenten den Besitz einer Partitur erlaubt hat, was den Musikern, wie sich der Meister ausdrückte, „eben etwas mehr abverlangt, als bloßes Notenablesen und sie stattdessen zum gewünschten ‚Erahnen ’der Klänge“ führe.
Damit aber genug zu den Begleitumständen dieser vielbeachteten Uraufführung, um die sich – soviel sei an Hintergrundinformation noch verraten – dem Vernehmen nach auch das Stadttheater Baden und die Alternative Bühne Neusiedl am See, dank des unermüdlichen Einsatzes unseres verehrten Opernhofdirektors Öaoam Niederträchter aber erfolglos, beworben haben.
Die Inszenierung von Cristobal Balenciaga ist dank des unermüdlichen und persönlichen Einsatzes unseres verehrten Opernhofdirektors Öaoam Niederträchter großartig gelungen: Nie überladen, stets zurückhaltend und immer auf die Musik ausgerichtet. Die herrlichen aber kargen Bühnenbilder Herrmann Nitschs, die auf italienischen Landschaftsmalereien des 19. Jh. basierten und auf die sonst üblichen, nur als Koketterie zu bezeichnenden Bezüge zur Handlung wohltuend verzichteten, rundeten den idealen Rahmen für dieses Meisterwerk ab.
Durch die symmetrische Choraufstellung und die wunderschönen, geschmackvollen Kostüme aus den Privatgarderobebeständen von Alfons Haider und Günter Bischof wurde nicht nur die Triumphszene ein wahres Fest für die Augen. Aber Balenciaga gelangen nicht nur die Massenszenen: Auch in den intimeren Momenten wie im Mochovce-Akt oder in der durch die Strangulierung einer Giraffe gegenüber dem ursprünglichen Entwurf deutlich aufgewerteten Schlussszene gelang es dem Regisseur, die notwendige Intimität am Fuße der vulkanischen Krustenverwerfungen herzustellen. Dies ermöglichte auch das Spiel auf parallelen Handlungsebenen, was sich vor allem auf das Finalbild positiv auswirkte.
Nun soll aber der Kritik an der Musikkritik, der zu Folge diese längst zur Betrachtung der Regieleistung heruntergekommen ist und das Sichtbare bloß in seinem Verhältnis zum Textinhalt befragt, nicht Wasser auf die Mühlen geleitet werden.
Die Wertung der interpretatorischen Leistung soll hier keineswegs hintenan stehen. Mit besonderem Interesse ist ja die Interpretation der von Kammersängerin Henriette Schreyvogel übernommenen Schlüsselrolle der Gräfin von Schreckschraub erwartet worden, hatte der Komponist doch die Stimmlage dieser Partie etwas kryptisch und im Gegensatz zu den sonst im Rahmen der Erwartungen gebliebenen Klassifikationen – Sopran, Alt, Tenor, Bass – mit „Sehr Alt“ angegeben. Die Königin der Koloraturen stellte sich respektvoll den gefährlichen Höhen ihrer Partie, die sie mit leicht geführter, glockenreiner Stimme ebenso bravourös meisterte, wie das lyrische Lamento des gebratenen Schwans im effektvollen „dulcissime“ . Aber auch das übrige Esemble konnte überzeugen: Für die ursprünglich der Pariser Fassung vorbehaltene Partie des Mecki Beckmesser konnte der aus der niederschlesischen Oberlausitz stammende, italo-afghanische Nachwuchstenor Cravatto Cravallini verpflichtet werden, bei dem es aber unglücklicherweise auf Grund seines Nebenberufs als Pornodarsteller zu einer Termi kollision gekommen war: Der gefragte Star hatte zur selben Zeit für die Aufzeichnung eines pornographischen Liederabends in Osaka zur Verfügung zu stehen, sodass seine Stimme – wenn auch live aus Osaka – nur elektronisch und unter Ausnützung seiner dortigen Drehpausen sowie ohne Rücksichtnahme auf den Handlungsverlauf der Aufführung eingespielt werden konnte. Die Rolle der blinden Helikopterpilotin Reinmara, für die die Doyenne des Ensembles der Staatsoper von Reinwahnien, Rosobalda Perforata die Jüngere verpflichtet werden konnte, fiel einem beherzten Strich des verehrten Opernhofdirektors Öaoam Niederträchter zum Opfer und wurde durch einen zauberhaften, von ihm selbst ad-hoc komponierten „Epilog der Isotopen“ ersetzt, der von einem stimmlich durchwegs überzeugenden Chor der Edelknaben dargeboten wurde.
Insgesamt also ein durchwegs gelungener Abend, wenn auch der Titel des Werks – „Anzeichen für vulkanische Tätigkeit in Mitteleuropa“ – sosehr er in bester Haydn´scher Opera-Puffa-Tradition stehen und mannigfache Bezüge zur intelligent konstruierten Handlung herstellen mag, im Vergleich zu den anderen Hauptwerken der Opernliteratur etwas sperrig erscheinen will.