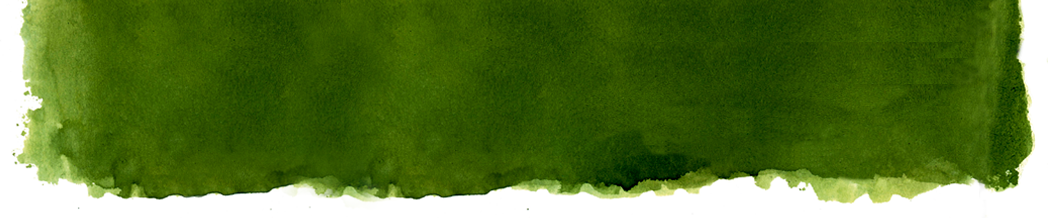Eine Suche

Loicht Stefan
Gestatten, Gottlieb Amadeus Heidenschreck mein Name, ausge-bildeter Wallfahrtswarenhändler von Beruf und damals Kurator des erzbischöflichen Kuriositätenkabinetts. Damals? Lassen sie mich die Zeit und den Bischof verschweigen, das ist besser für Ihr Seelenheil.
Aber der Reihe nach: ich war gerade mit dem Polieren einer unser heiligsten Reliquien, einem eingewachsenen Zehennagel des Prälaten Ignaz Seipel, beschäftigt, als unser Domherr mit einem Auftrag an mich herantrat. Im Zuge einer Wallfahrt in St. Keppelin an der Urschel sei am Matthäus-Bildstock der südburgenländischen Zollwache nach dem allzu heftigen Anschmiegen einer übergewichtigen Gesundheitsministerin eine lang verschollen geglaubte Inschrift zu Tage getreten, die die Legende, wonach der heilige Severin den pota phadraig des heiligen Patrick in das Land unter der Enns brachte, zur Wahrheit erheben könnte.
Nicht auszudenken wäre es, wenn dieses mythische Gefäß, der Bierkrug, der sich niemals leert, in die falschen Hände geräte: die Missionierung des katholischen Kernlandes Mitteleuropas, des abendländischen Bollwerkes wider die Ungläubigen, würde sich als Schnapsidee eines hochgradig bezechten Iren, sich einen Spaß aus der Gottesfürchtigkeit hiesiger Hinterwäldler zu machen, erweisen.
Wenn der pota existierte, musste er unbedingt gefunden und in kirchliche Obhut gebracht werden. Und ich war der Richtige für diese Aufgabe.
Mit modernsten kriminaltechnischen Mitteln ausgestattet nahm ich alsbald den erwähnten Bildstock unter die Lupe. In dieser sah ich etwas, das ich mit Butterbrotpapier und einem Bleistift der Stärke 3,7 abpausen konnte: eine schwer zu entziffernde Intarsie, das Vermächtnis von Hunwulf, des Bruders des Odoaker. Dieser hatte bekanntlich mit diversen Kavents-, Henkel- und Werkelmännern die Gebeine des Severin nach Italien überführt.
Offensichtlich hatte Hunwulf aber am Weg nach Süden in der Gegend des heutigen Thermalkurortes Bad Mood einen depressiven Anfall, den er mit dem im Schrein mit den sterblichen Überresten des Heiligen befindlichen pota bekämpfte. Berauscht verlor er ihn, was einen Kater biblischen Ausmaßes hervorrief, der nur durch die Ausrottung der dortigen Landbevölkerung gelindert werden konnte.
Es gab den pota also! Nur, wo ist er jetzt? Um den heidnischen Hyänen zuvorzukommen, brauchte ich dringend genauere Informationen. Im romanischen Surmeum (der Ruhmeshalle der ruralen supranasalen Oligosynaptiker, vulgo Dorftrotteln) im unweiten Strunzenstrauch glaubte ich, fündig zu werden, da der Sage nach nur die größten Deppen im Burgenland Hunwulfs Schlachten überlebten. Und siehe da: am Epitaph von Timotheus Simandl kann man die Züge von Innozenz, dem Indiskutablen, ein zu Recht vergessener Gegenpapst, der sich am zweiten Weiberkreuzzug selbst heilig gesprochen hatte, erkennen. Dieser war in jungen Jahren ein Ge-
fährte von Edelheim, dem Entarteten, der sinnsuchend mehrmals
die Religion gewechselt hatte und schließlich das Kärntner Kalifat
in Kukurutschnig gründete.
Also über die Pack! Edelheims Alcazar wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals umgebaut und –genutzt, nach einem Seniorenstift für Kasnudeldrucker war dort zuletzt ein Flüchtlingsheim für transnistrische Dragqueens untergebracht, deren berühmteste Serafina Urechean war. Alleine der Farbton ihres polysterolen Herrenbikinis – „Blönd“ – brachte den Landeshauptmann fast um den Verstand, also war es doch kein Wunder, dass diese Institution in diesem seltsamen Land wohlgelitten war.
Den nächsten Hinweis vermutete ich auf Edelheims Grabplatte, die die Zeitläufte als Basis des Abtritts überlebt hatte (wie ich aus den Beschreibungen im Ödhio wusste); das Problem war nur, wie konnte ich mir Zutritt verschaffen? Zum Glück stand der Kukurutschniger Fasching an, der traditionell in der Fummelburg, wie das Gebäude im Volksmund genannt wird, stattfindet. Unschlüssig, ob ich meine gewohnten Verkleidungen als Veilchen oder als Logarithmus verwenden sollte, entschied ich mich schließlich als Aladins Wunderschlampe zu gehen, was mir in Anbetracht der im Wortsinn herrschenden Verhältnisse als am unauffälligsten erschien.
Gedacht, getan und drinnen war ich. Jetzt noch auf den nunmehrigen Huldigungsbalkon (eben der ehemalige Abort) und die Steinplatte näher untersuchen. Aber es lief bisher zu glatt, wie ich erkennen musste und zwar in der Person von Rollo Sonnenblend, einem Agenten von ZARA, der Zentralvereinigung agnostischer Rabulistiker Austrias, der als Gleitcremetube kostümiert war. Ein Blick in seine stechend roten Augen verriet mir und ihm, dass wir in derselben Sache unterwegs waren. Jetzt war Phantasie gefragt.
Kamerad Zufall war mein Freund, denn der Pressesprecher des Landesvaters sprach mich an. Ich konnte seine Aufmerksamkeit auf Sonnenblend lenken, in dem ich ihn als Vertreter des ihn schmückenden Produktes pries. Und schwupps! schnappte dieser Jüngling meinen wehrlosen Widersacher, um mit ihm über ein Joint Venture zu verhandeln (er hatte auch schon einen Slogan „Kärnten fährt ein“, das nur nebenbei).
Die Bahn war frei. Auf Edelheims Grabmal konnte ich dank meiner treuen Lupe eine Miniatur entdecken, die 700 nackte fastende Zwerge zeigt. Dieses Bild war mir bekannt. Aber woher? Grübelnd verließ ich das Fest, den unglücklichen Sonnenblend in den Fängen ihn ausquetschender verschnupft sprechender liederlicher Lüder-jahne zurücklassend.
Es blieb mir nichts anderes übrig, als zu meiner Bibliothek zurück-zukehren, um das Bild zu suchen, das den Schlüssel zum Hort des pota enthält. Ich wusste, es muss etwas mit der Geschichte der Päpstinnen zu tun haben, denn der nackte, fastende Zwerg war seit alters her eine Allegorie des Kammerdieners im pontifikalen Matriarchat. Und ich wurde fündig: in Giselher Grobschnitzers 1837 erschienener hyperrealistischer Parabel „Zwei Hühner auf dem
Weg nach Vorgestern“ (die ein Gleichnis der weiblichen Rückbe-
sinnung auf die Idealfigur ist).
Auf Seite 112 findet sich eine Zeichnung der Miniatur, eingebettet in eine Textstelle, die sich mit dem Massenaufstand der alpenländischen Eremiten von 1188 beschäftigt. Derzufolge hat ein vielstimmiger Trappistenchor eine Lawine ausgelöst, die den Tross der päpstlichen Nuntia beim Überqueren des Passo Doble verschüttete. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Der Weg über den Passo Doble führt in den Vinschgau, Grobschnitzer war im Zivilberuf Registrateur im k.k. Hoftrommeldepot. Natürlich! Eines der verschütteten Tragtiere, ein seltener andalusischer Albinoesel wurde nach seinem Hinscheiden zu einer Trommel verarbeitet, die anlässlich des 79jährigen Jubiläums der Schlacht von Kolin 1836 dem Linieninfanterieregiment Nr. 99 („die gelben Teufel von Znaim“) übergeben wurde.
Der Kommandant, Freiherr Frantisek Pitomost, war in seiner Freizeit Tempelritterdarsteller auf der nahe gelegenen Ordensburg in Cejkovice, die erstmals im Jahre 1248 in einer Urkunde von Oldrich von Sponheim („Adum est hoc in Schaeikwitz“) erwähnt wird. Nun also auch die Templer! Warum nicht gleich die Illuminaten? Na, und wie es der Teufel so will, finde ich auf der 23. Stufe zum 4. Wein-
kellergeschoß in der südmährischen Feste den Namen „Pater Ladislaus Zalunzny Ritter von Pogonia“.
Dieser wurde im Mai 1900 Pfarrer von Obermeisling (wie man aus der Ortschronik von Gföhl weiß). Der Fama nach wurde er wegen laesio enormis beim Ablasshandel geklagt und verurteilt, was ihm auch den Spitznamen „Vizekonsul der dunklen Seite“ eintrug. Er hatte enge Verbindungen zu der Geheimgesellschaft des Jörg Lanz von Liebenfels, der zwar ein Spinner war, aber Adolf Hitler prägte und mit Fritz von Herzmansovsky-Orlando korrespondierte und den Ordo Novi Templi gründete. Es passte alles zusammen. Wer ein Buch mit dem Titel „Die Theozoologie oder die Kunde von den Sodoms-Äfflingen und dem Götter-Elektron“ veröffentlicht, muss tüchtig vom pota getrunken haben.
Ich entsann mich eines Freundes meines Vaters, ein Hobbyarchäologe mit dem Beinamen Virginia - Jonas (er belieferte später Julius Raab mit Zigarillos), dessen Mutter eine Nonne der Unbeschuhten Karmeliterinnen in Niederösterreich war. Ein käsiger Geheimrat des Ringvereines der Falschmünzer und Forstfrevler namens Immanuel Vogelscheuch hatte ihm einst von einer geheimnisvollen Zusammenkunft unterschiedlichster Würdenträger im Hause von Michelangelo Baron von Zengg - auch ein Neutempler - berichtet, die zwar als Tanzstunde für die reifere Jugend annonciert wurde, aber
in einer Orgie unterging, obwohl keine Getränke bestellt waren.
Ich machte mich also auf die Suche nach den Nachfahren des Barons; das Zenngsche Palais wurde, wie ich wusste, in der Zeit der großen Inflation gegen ein Erdäpfelgulasch getauscht, war dann eine Gauschulungsburg von Niederdonau, landete im Restitutionsfonds der freien Gewerkschaften und wurde schließlich an die Bundesbahnen verkauft, die es demolierten. Heute ist dort der Monika-Forstinger-Park.
Ein Enkel, Damian Senj, arbeitete als Hauszusteller für die U-Bahnzeitung. Den schloss ich als Wissenden aus. Ein anderer versuchte über das Balzverhalten der gemeinen Bratwurst zu dissertieren, was ihn auch nicht als Geheimnisträger auswies. Eine Großnichte entwickelte eine Gebärendsprache für Wöchner, die ausschließlich mit Grunzlauten auskam. Was war diese Familie nur für eine Evolutionsbremse (soviel zu Intelligent Design)!
Der einzige aus diesem genetischen Sumpf, der in Frage kam, mir weiter zu helfen, war ein Urenkel, dessen Namen ich nicht nennen werde, und Billeteur im Praterkino. Ich verschaffte mir eine Ehren-karte (ein Freund von mir ist Stammgast in Rudis Sportstüberl am Praterstern) zur Premiere von „Der sich den Wolf tanzt“, die in seinem Etablissement stieg. Ich konnte ihn unter Interessens-
heuchelung an seinem cineastischen Erfahrungsschatz überreden, mit mir nach seinem Dienstschluss auf ein oder mehrere Gläser in die „Kleingeisterbahn“, dem Treffpunkt der örtlichen Honoratioren, zu gehen.
Nachdem er mein Spesenkonto nicht sonderlich belastet und mir seinen Lieblingsfilm „Brutale Salami-Bräute lesen Rilke Teil IV“ haarklein nacherzählt hatte, konnte ich zum Punkt kommen: was wusste er über den Verbleib der Fahrnisse seines Urgroßvaters? Er schien nicht sehr überrascht, wie jemand, der schon lange, darauf wartet, dass sein Geheimnis, das er doch nicht weitergeben kann, von einem Fremden gelüftet wird. In seinen Augen leuchtete ein fernes Licht von Bedeutung und Erleichterung. Ich musste ihm nur noch eine Flasche Ouzo und das neueste Buch von Franzobel versprechen, dann würde er mir alles sagen.
Und tat es auch: der familiären Überlieferung nach wurden kurz
vor dem frugalen Handel drei versperrte Kisten des Barons zu
seinem Vetter nach Böheimkirchen gebracht. Dieser hat sie zuerst im Schweinestall gelagert und vor Kriegsende im Wald vergraben. 1955 wollte er sie wieder ausgraben, vergass aber in der Zwischenzeit die Stelle. Sein Eidam ist dann Jahre später – zufällig, denn er wollte seinen quietschgrünen C-Kadett entsorgen - auf die Kisten gestoßen.
Nachdem er sie auf seinen Hof geschafft hatte, kam ebenso zufällig ein Mann des Weges, der einiges (in bar) für die Kisten bot. Der Schwiegersohn nahm das Angebot an (es war ungefähr der Gegenwert eines gebrauchten D-Kadetts) und verpflichtete sich, sie an eine bestimmte Adresse zu liefern. Ich fürchtete schon, hier am Ende des Weges zu sein, als mein Gesprächspartner einer vergilbten, eingerissenen Zettel aus seiner sonst leeren, speckigen Geldbörse nahm. „Fragen Sie mich nicht, woher ich das habe“, sagte er, „aber gegen eine Flasche Absinth können Sie es haben“. Ich gab ihm Geld für zwei.
Sie können sich sicher vorstellen, wie mir – natürlich metaphorisch gesprochen – der Geifer aus den Mundwinkeln rann, ich vor lauter Aufregung beim Verlassen des Lokals fast Rollo Sonnenblend, der seltsamerweise einen sehr steifen Gang (so ähnlich wie John Wayne als kleines Mädchen) hatte, umrannte und schließlich zitternd im fahlen Licht der Notbeleuchtung des Hinterausganges einer Bingo-Spielhölle die Zeile „ Wiener Straße 38, 3100 St. Pölten“ las.
Zwei Stunden später drückte ich auf einen Klingelknopf. Was ich sah, verwirrte mich. Der bucklige Nachtportier überraschte mich schon nicht mehr. Er nahm mein erzbischöfliches Legitimationsschreiben und hieß mich zu warten. Schon nach fünf Minuten kam der Regens des Priesterseminars der Diözese St. Pölten, optisch eine Mischung aus Dieter Bohlen und Ewald Stadler, und erkundigte sich äußerst liebenswürdig nach meinem Begehr.
Ich stammelte meine Geschichte, der Regens war nicht im Geringsten verwundert und sagte: „Ja, ja, ich glaube meine Brüder haben so ein Ding. Sie nennen es den Becher eines Zimmermanns. Bei der Vesper lassen sie es immer herumgehen. Aber sehen Sie selbst.“
Und in einem resopalverkleideten Küchenkästchen, da stand der pota, kein Zweifel. Er roch nach billigem Rasierwasser, wie es polnische Zuhälter verwenden, und war voll mit schäumendem Gebräu. Ich nahm ihn und einen Schluck. Über 1500 Jahre alt und frisch wie am ersten Tag.
Ich nahm dem Regens das Versprechen ab, zu niemandem ein Wort zu sagen und eilte zu meinem Bischof, um ihm die frohe Kunde vom Fund und Aufenthalt des pota zu bringen. Er empfing mich im Schlafrock, lauschte meiner Odyssee, schüttelte lächelnd den Kopf und sagte: „Na, das hätte ich mir gleich denken können. Die mit sihren Bubendummheiten. Von nix kommt nix. Aber dort ist er gut aufgehoben und der Altbischof wirds mir danken.“
Bar jedes Verständnisses fing ich an, zu schreien und zu toben, ob es denn all die Mühe wert gewesen ist, den pota zu suchen und zu finden, wenn er dann zwischen Bet- und Bettmännern in einem Provinzkaff missbraucht wird, anstatt gut behütet in den Vatikanischen Archiven wohl verwahrt zu sein und sein Geheimnis vor der Welt behält.
„Mein lieber Heidenschreck“, antwortete der Bischof ernst, „erstens ist beichten einfacher als Moral. Zweitens müssen wir den spärlichen Nachwuchs ja irgendwie motivieren. Drittens denken Sie an Ihre Pension, gehen sie brav wieder polieren und verlieren Sie kein Wort über diese Geschichte, da Sie in Lohn und Brot des Klerus stehen.“
Niemals werde ich die Worte meines Bischofs vergessen, die er mit einem Gesichtsausdruck, der an jenen Andreas Mölzers, wenn er Barbara Rosenkranz beiwohnt, gemahnte, darbrachte: „Heidenschreck, denken Sie, bei aller katholischer Schuldlust, stets daran: cuius regio, eius religio.“