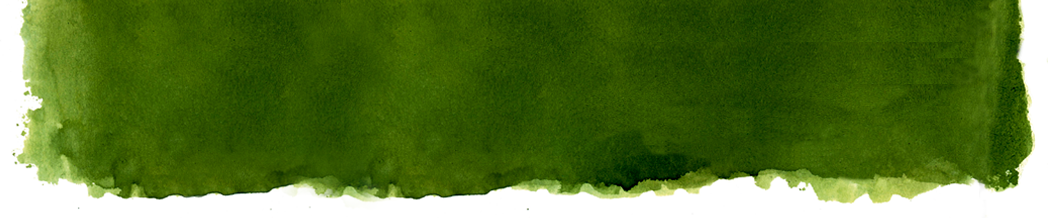Großer Bahnhof

Nowak Günter
Vorbemerkung
Franz-Josefs-Bahn, nach dem Krieg von 1866 errichtete Eisenbahnverbindung von Böhmen nach Wien, erhielt 1872 in Wien 9 den ersten Kopfbahnhof innerhalb des Linienwalls (Gürtel), quert bei Tulln die Donau; in Absdorf-Hippersdorf zweigt die Donauuferbahn über Krems nach Mauthausen- St. Valentin ab. Da die Franz-Josefs-Bahn 3 Bezirkshauptstädte im Waldviertel nicht berührt (Horn, Zwettl, Waidhofen an der Thaya), wurden diese mit Nebenlinien angeschlossen. Der Gabelungsbahnhof Gmünd fiel 1919 an die CSR, sodass ein neuer Grenzbahnhof bei Gmünd gebaut werden musste.
Zum Bitzinger
Wahrscheinlich ist sie dort angekommen. Sicher kam sie mit der Bahn. Es war das zweite Jahr des großen Schlachtens und man war damals schon viel weniger begeistert vom Hurrageschrei und „Serbien und dessen Sterbien“. Trotzdem kam man – wenn man Arbeit suchte - immer noch ins Zentrum des zugrunde gehenden Riesenreichs und fand diese mitunter sogar noch „bei Hof“. In ihrem
Fall würde die Arbeit bei Hof die einer Köchin in Laxenburg sein, kochen konnte sie ja von zu Hause her und waschen auch. Sie hatte gerade noch das 19. Jahrhundert erlebt, und war als Älteste von mehr oder weniger zehn Kindern ganz knapp an der Nordostgrenze der Monarchie aufgewachsen. Als ältestes Mädchen unter den Geschwistern musste sie gehen oder schwanger werden oder heiraten, was ja letztendlich ohnedies alles dasselbe war und so kam sie –
gerade sechzehnjährig – mit ein paar Kreuzern und ein bisschen
Wäsche in einem Pappkoffer auf diesem Bahnhof in Wien an.
Kann sich heute eigentlich noch jemand daran erinnern, dass es einmal in Wien zwei Burgen gab? Nein, nicht die Hofburg – das war ja keine richtige Burg -, sondern eine echte Burg mit Mauern mit Zinnen und Toren und Türmen. Eigentlich gab es damals in Wien sogar noch viel mehrer von diesen echten Burgen, aber solche Schutz- und Trutzeinrichtungen wie es zum Beispiel das Arsenal war, waren in dieser Zeit genauso unerreichbar weit weg wie Tirol oder das Meer oder Amerika: Zumindest aus der Perspektive eines Kindes, das in der proletarischen Kampfzone der Brigittenau der 60er Jahre aufwuchs, begrenzten genau zwei Burgen die eigene Welt. Beide lagen jenseits des Kanals – und zwar wenn man nach links hinten schaute, die Rossauerkaserne und vorne gerade und dann ein bisschen rechts – der Franz-Josefs-Bahnhof.
Nun gab es damals mit den Burgen ein Problem: Keine Burg ohne Ritter, aber die waren offensichtlich irgendwann genau so ausgestorben wie die Indianer und die Dinosaurier. Die Indianer tauchten zwar trotzdem manchmal noch auf – zumindest im Schichtarbeiterprogramm oder im Messefernsehen in Schwarz - Weiß - und von den Dinosauriern gab´s im Naturhistorischen Museum (das war auch fast wie eine Burg) zumindest noch die Knochen. Von den Rittern waren aber offensichtlich nur Rüstungen, Schwerter und Schilde geblieben, und insofern war das eine ziemlich traurige Sache für ein phantasiebegabtes Kind. Aber immerhin gab es noch Burgen, und in einer von diesen Burgen – der Rossauerkaserne - wohnten damals die Polizisten, das waren irgendwelche Nachkommen der Ritter, wenn auch ohne echte Rüstung.
Noch komplizierter lag die Sache mit der anderen Burg, die sah zwar ganz so aus, wie eine Burg eben auszusehen hatte, war aber jetzt ein Bahnhof. Es handelte sich um einen mächtigen Backsteinbau, mit großem Burgtor und zwei Türmen, die sich mächtig gegen den Julius-Tandler-Platz abhoben und hieß Franz-Josefs-Bahnhof. Wahrscheinlich war die Umwidmung des Gebäudes passiert, weil die Ritter ausgestorben waren, aber vielleicht war das auch noch eine Idee von einem dieser Raubritter wie den Kuenringern gewesen.
Die Ursache für diese – für ein Kind überaus widmungsfremde Nutzung - tut aber nicht viel zur Sache, viel wichtiger ist, dass jede Burg noch zwei weitere entscheidende Merkmale haben musste, nämlich eine Burgküche und einen Rittersaal. Aus irgendeinem noch weit
seltsameren Grund lagen diese entscheidenden Räumlichkeiten nun aber nicht mehr in der Burg, sondern außerhalb der Mauern und hießen jetzt „Stehweinhalle Bitzinger“. An der gegenüberliegenden Ecke vom Bitzinger gab es damals auch noch das Kleiderhaus zum Eisenbahner. Der Franz-Josefs-Bahnhof, der Bitzinger und eigentlich auch der Eisenbahner gehörten so untrennbar wie eine Burg zusammen und als der Bahnhof geschliffen wurde, ging es auch mit der Steh-weinhalle und dem Kleiderhaus bald zu Ende.
Was in einer Kinderphantasie der frühen 60er Jahre als Burgküche seinen Anfang genommen hatte, fand rund zehn Jahre später, bis zum Ende dieses Etablissements, eine konsequente, nahezu allsonntagliche, Fortsetzung. Nur wurde irgendwann das OBI gegen Bier ausgetauscht.
Sie stand nun wieder am Bahnhof, wie schon einmal vor zwei Jahren, und bestieg einen Zug zurück in ihre Vergangenheit. Viele Jahre später erzählte sie, dass das damals verrückte Jahre gewesen seien – man habe sich auch mit wenig Geld wirklich gut unterhalten können. Sie erinnerte sich an die großen Unterhaltungsetablissements, sie wohnte ja auf halbem Weg zwischen Rotunde und Zirkus Renz.
Nun war sie wieder schwanger und so fuhr sie zur Geburt eines zweiten Kindes zu ihrer Mutter und ihren Geschwistern. Er kam dort zur Welt, der Ort hieß Dobra Voda oder Gutwasser, und es war die Zeit und die Gegend eines Hennlein und seiner Sudetendeutsche Partei (SdP). Das erste Kind war unmittelbar nach der Geburt gestorben, das zweite aber lebte. Wenige Tage nach der Geburt bestieg sie wieder den Zug und fuhr nach zurück nach Wien. Sie war Arbeiterin, aber keine Mutter.
Vierzehn Jahr später stand auch er auf diesem Bahnhof und war zum ersten Mal in seinem Leben in einer Stadt. Er war zwar einmal als kleines Kind nach Budweis gekommen, aber da hatte er Diphterie gehabt, war bewusstlos gewesen und ein Onkel hatte ihn am Rücken fast fünfzig Kilometer ins Spital getragen. Deshalb lebte er noch und alle anderen waren gestorben – und am Bahnhof sah er zum ersten Mal in seinem Leben seine Mutter. Wahrscheinlich hasste er sie von diesem Moment an.
Die 60er Jahre in Wien waren übrigens grauenhaft und die Moderne kam, entgegen allen anderen Darstellungen, erst dann nach in diese Stadt als im Bitzinger die Tische im Vorraum, der sogenannten „Schank“, mit Resopalplatten überzogen wurden. Es sei hier angemerkt, dass es nicht zu verstehen ist, dass bisher noch niemand eine Kulturgeschichte der Stehweinhallen in Wien verfasst hat, obwohl der Markt von sentimentalem Geschwätz über Heurigenkultur und Kaffeehausliteratentum nur so überquillt. Analoges gilt übrigens auch für eine noch ausstehende Kulturgeschichte des Branntweiner- vulgo Brandinesertums in Wien, aber das ist nicht unsere Geschichte obwohl man sicher auch aus dieser Perspektive den Franz-Josefs-Bahnhof verstehen lernen könnte. Faktum ist: Wer die 60er und 70er nicht zumindest zeitweise beim Bitzinger oder in einer der anderen Stehweinhallen verbracht hat ist ahnungslos über diese Zeit in Wien.
Um das Phänomen Bitzinger verstehen zu können, muss man wissen,
dass das Lokal, abgetrennt durch einen Paravent aus Milchglas in
einen Speisenbereich und „die Schank“ geteilt war. Letzte bestand
aus der eigentlichen Schenke, in der Mehrzahl besehend aus Steh-tischen und nur wenigen Sitzgelegenheiten. Diese waren aber ausnahmslos von Stammgästen belegt, die einzigen Personen übrigens, die in diesem Lokal jemals Wein in Achtelliter-Einheiten zu sich nahmen. Um damals Wein in Achteln zu trinken, musste man die Weihen eines Alkoholikers erreicht haben, der vermutlich in dieser Form heute nicht mehr existiert.
Grundsätzlich bedeutete damals die Bestellung eines Glases Wein, die Bestellung „eines Vierterls“ – andere Gebinde gab es auch kaum. Der Wein unterschied sich in die Sorten Rot oder Weiß oder Heuriger und außerdem noch den „Besseren“, doch dabei handelte es sich eigentlich um Wermuth – naturgemäß auch im Viertelliterglas.
Getränke wurden beim Ober - dieser hieß tatsächlich „Herr Franz“- bestellt, Speisen, sie lagen in einer Schauvitrine und erinnerlich sind heute eigentlich nur mehr Teufelsroller, Salzstangerl mit Schinken, Ölpfefferoni und eine Sorte Käse, die damals für Emmentaler gehalten wurde. Die Speisen musste man – ähnlich einem Heurigenbetrieb – selbst an der Schank abholen. Für Speisen und Getränke gab es Rechnungen, die an einer Kasse links von der Eingangstür, bei Verlassen des Lokals zu bezahlen waren. Gehütet wurde diese Kassa von einer Dame mit monomental aufgetürmter Frisur. Die Besucher des Speiseraums wurden bedient; außerdem gab es dort sogar Tischdecken.
Der Krieg dauerte nun auch schon mehrere Jahre und sie stand wieder am Bahnhof. Die Wehrmacht stand tief im Gebiet der Sowjet-union und noch überschlugen sich die Jubelmeldungen. Sie bestieg den Zug um Unerhörtes zu tun. Ihr Sohn hatte nach knapp drei Lehrjahren mit 17 Jahren seinen Einberufungsbefehl erhalten und die Grundausbildung am Truppenübungsplatz Allentsteig überlebt. Der Marschbefehl für den Panzerfahrer lautete auf den folgenden Tag und führte nach Osten.
Am späten Abend stand sie vor den Toren des Truppenübungsplatzes und verlangte, dass man sie diese letzte Nacht vor seinem persönlichen Krieg bei ihrem Sohn verbringen ließe. Vermutlich weil ein solches Ansinnen vollkommen einzigartig und eigentlich unvorstellbar war – eine Zivilperson in einer militärischen Sperrzone der Nazis eine Nacht vor Truppenabmarsch – ließ man sie tatsächlich gewähren. Was sich genau in dieser Nacht – eine Frau mit ihrem Sohn inmitten eines Saales blutjunger Rekruten, die am nächsten Tag an die Front geschickt wurden – weiß heute niemand mehr. Vermutlich saß er am nächsten Tag in einem Zug nach Osten, sie aber war am Abend zurück und stand am Bahnhof in Wien und er kam dann bis Smolensk.
Der Franz-Josefs-Bahnhof wurde in der zweiten Hälfte der 70er Jahre abgerissen und 1978 durch den heute noch bestehenden Bau ersetzt. Das Kleiderhaus zum Eisenbahner stellte ungefähr zur selben Zeit seinen Betrieb ein und auch der Bitzinger überlebte seinen Bahnhof nicht.
Er kam 1947 – diesmal aber nicht mit der Bahn - nach Jahren der Kriegsgefangenschaft wieder zurück nach Wien, nur um einer Frau, die er auf einem Fronturlaub im Prater kennengelernt hatte – sie kannten sich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht länger als insgesamt 24 Stunden – einen ultimativen Heiratsantrag zu machen. Nach eintägiger Bedenkzeit stimmte sie zu und sie heirateten im folgenden Jahr.
Man sprach grundsätzlich nicht über die Zeit, auch nicht mit dem viel später geborenen Sohn. Eigentlich sprach man immer schon wenig und dann noch immer weniger. So war und blieb ein gemeinsamer Besuch beim Bitzinger die – mehr oder weniger freiwillig verbrachte – einzige familiäre Gemeinsamkeit zwischen Vater und Sohn in den 70er-Jahren.
Irgendwann und irgendwie hatte der Sohn zwar die Ursache des seltsamen Verhältnisses zwischen Vater und Großmutter entschlüsselt, es bedurfte aber eines gemeinsamen Besuchs bei Bitzinger um ein wenig mehr zu wissen, verstehen würde er es ohnedies nie ganz.
Die Aura einer Stehweinhalle in Wien in den 70er Jahren kann man heute nur mehr schwer zu vermitteln. Es war eine verquere Mischung aus einer Bahnhofshalle und einem Heurigen, allerdings nur dann, wenn man von diesem Bild alles, was Grinzing ausmacht, entfernt.
Das Licht war in der Regel gedämpft – es dominierten Holzverkleidungen, Milchglasscheiben und schwerer Rauch, wobei die Luftqualität aufgrund der schieren Größe und Höhe der Hallen in der Regel deutlich besser war als in jedem sonstigen Gastronomiebetrieb dieser Zeit. Die Wände waren behängt mit wahrscheinlich immer schon vergilbten Darstellungen der Wiener Weinkultur – zumeist direkt auf die Wände gemalt, auf einer Vielzahl an Tafeln waren Listen von Weinen vorgedruckt und nur mehr mit Preisangaben zu ergänzen, wobei die eigentliche Auswahl wie schon erwähnt eher eingeschränkt war. Als Bier gab es Hopfenperle, und die kostete beim Bitzinger als Krügerl zum Zeitpunkt des Zusperrens elf Schillinge.
Der Bitzinger war schier zu groß für das was er damals noch war, er war schon mehrmals in seiner Geschichte die erweiterte Ankunftshalle eines der großen Bahnhöfe großer und größenwahnsinniger Reiche gewesen. Der Bitzinger war auch eine Parabel auf das Wien des 19. und 20. Jahrhunderts. Er war gleichzeitig ein Denkmal für eine Kultur des Alkoholismus und für die Bedeutung eines großen Bahnhofs. Saufen führt konsequenterweise dahin und ein Kopfbahnhof ist definitiv das Ende, daher wirken beide so sprachlos und gleichermaßen beredet.
Den Ring hatte er übrigens schon ein paar Wochen zuvor beim Stöbern in einer alten Vitrine gefunden und – weil dieser Ring mit seinem seltsamen Siegel für einen Sechzehnjährigen ausreichend martialisch schien – auch sofort an seinen Finger gesteckt. Einigen Mitschülern war das seltsame Schmuckstück aufgefallen, aber auch nicht sehr.
Als der Vater den Ring auch eher zufällig am Finger des Sohns sah – das war an einem Sonntagvormittag des Jahrs 1976 und bei einem Seidel Bier – sagte er nur – und das ohne in irgendeiner Form erregt zu wirken: „Nimm das runter - das ist der Ring eines Mörders“. Nicht mehr.
In Smolensk hatten sie sich schon längst im Dreck und Morast festgefressen als die Rekrutierungskommandos der Waffen-SS auftauchten. Sie versprachen gute Ausrüstung, natürlich den Endsieg und einen militärischen Einsatz weit weg von der Sowjetunion und dem bedrohlichen Winterfeldzug. Er ging. Guderian. Überschwere Panzerdivision. Ardennen. Der Rhein. Sein fahnenflüchtiger Freund wird in seinem Geburtsort Worms zwei Tage vor Kriegsende aufgehängt. Er überlebt. Er wechselt die Uniform mit einem toten Wehrmachts-soldaten und zerreißt seine Papiere. Längst fahren keine Züge mehr. Er gilt als vermisst. Seine spätere Frau ist der einzige Mensch, der ihn in dieser Zeit vom Internationalen Roten Kreuz in den Kriegsgefangenenlagern suchen lässt. Deshalb heiratet er sie. Er war immer sehr pflichtbewusst.
Viele Jahre später verstand sein Sohn dann die Bedeutung einer
Narbe unter der Achsel, das Nichtsprechen und auch noch anderes Mehr. Einmal in seinem Leben konnte er sogar die Frage nach dem „Warum“ stellen. Zwei Sätze als Antwort, niemals mehr: „Wir waren für alle der letzte Dreck und ER hat gesagt ihr seid was wert. Dafür hätten wir dann alles gemacht.“
Sie starb übrigens 1984. Ihre alte Heimat sah weder sie noch ihr Sohn jemals wieder – die gesamte Gegend war bis 1989 militärisches Sperrgebiet und lag direkt am eisernen Vorhang und die alte Bahn gab es ja auch nicht mehr. Wenn sie dann manchmal noch nach Prag fuhr, um dort Freunde zu besuchen, musste sie vom Wiener Westbahnhof in den sogenannten Osten nach Westen fahren. Ich weiß nicht, ob sie jemals beim Bitzinger war, aber wahrscheinlich trank sie dort jedes Mal wenn sie abfuhr oder ankam ein Glas.
Über den Franz-Josefs-Bahnhof wird auf der offiziellen Informations-seite der Wiener Schnellbahnen - in einer Prosa, zu der wahrscheinlich nur ein PR-Mitarbeiter dieses Unternehmens befähigt ist – vermerkt, dass heute „der Bahnhof selbst ein wenig verlassen wirke“. Diese Beschreibung gilt offensichtlich als Marketing im Rahmen der Bahnhofsoffensive oder ÖBB. Dem Bitzinger folgte ein Schöps, seit einigen Jahren ist dort ein Drogeriemarkt untergebracht.
Nachwort:
Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass Paris auf seine Kopfbahnhöfe verzichten würde? Gar d´ Est, Gar´d Austerlitz usw. – das Alles sind nahezu unüberwindliche Hindernisse, wenn man dieses an und für sich ärgerliche Riesenstück von Land, das den Rest Europas von den erfreulicheren Regionen der iberischen Halbinsel so erfolgreich abriegelt, durchqueren muss.
Kopfbahnhöfe muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Man wird dort hingebracht, auch wenn man ganz woanders hin will oder muss. Man kommt dort an, man fährt nicht durch. Manchmal bleibt man auch. Irgendetwas endet an Kopfbahnhöfen imemer. Den Ring gibt es heute noch.