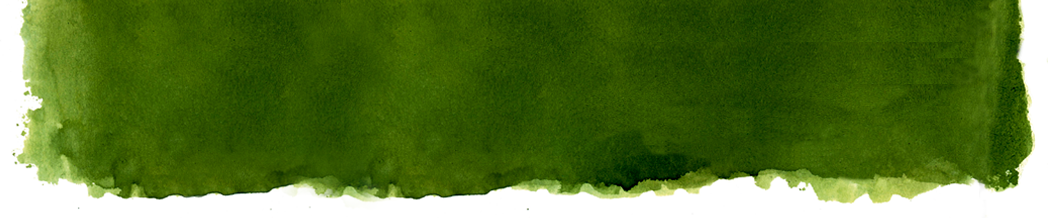Das Ding an sich ist der Krachmann
Harald Schmidt
Seine Protagonisten sind eine muntere, lustige oder zumindest ange¬heiterte Schar Ewig-Kreativer, welche in ihrem unsäglichen Wirken wohl alles nur Denkbare auszudrücken versuchen.
Da sind einmal die Herren Doktoren, allesamt der Muße gleichermaßen zugetan wie um die Muse bemüht. Sie befinden und erfinden in geschwungenen Reden, verstehen die kostbarsten Wortschätze aus ihrem Fundus zu heben und beträgt die Länge jedes Satzes zumindest zwei Fuß in Arial Narrow.
Den akademischen Widerpart bilden die Architekten und auch Diplomingenieure, welch Teufelswerk, mit künstlerisch – erste Gruppe – und professionellem Bemühen, die Sache ordentlich abzuarbeiten. Wer Pläne zu lesen vermag, dem mag sich vielleicht der Feinsinn ihrer trockenen Prosa erschließen.
Als Zentralgestirn ist ein Häufchen anzusprechen, dessen Mitglieder mit schier grenzenloser Phantasie und Zeit für Internetrecherchen begnadet sind. Ihre auf das Vielfältigste gesponnenen Geschichten verleihen dem Ding – und nicht nur der Sache – jenen geheimnisvollen wie humorigen Glanz.
Und schließlich, wenn Steve Jobbs in seiner Stanford-Rede den Tod als beste Erfindung des Lebens beschrieb, hatte er wohl keine Ahnung von der innewohnenden Dynamik der Krachmann-Schar, welche das Leben genießt und den Tod nicht braucht. Die Preise geben Zeugnis davon. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Das Ding an sich wird erst durch viele kleine Dinge, wo jedem Einzelnen der Schar obliegt die Pflicht, treu Jahr für Jahr sein Eigenes zu schaffen. Ob literarisch ein Juwel oder nur Schund, die Mischung macht das Ding schön bunt.
Die Fahrt ins Leben
Wie jeden Tag brachte K. seine Tochter in die Schule. Und wie jeden Tag schimpfte er über den stockenden Straßenverkehr und wie jeden Tag fand das Ornelia, so hieß seine 13-jährige Tochter, zum Lachen komisch. Sie verstand die Erregungen ihres Vaters nicht. Es amüsierte sie, ihn, den weltgewandten Unternehmensberater sein Nervenkostüm ausziehen zu sehen. „M&A Berater“ stand auf K’s Visitenkarte. Ornelia rätselte schon die längste Zeit über die Bedeutung von „M&A“. Ihr Vater sprach dann in ernsthaftem, langsamen Ton von strategischen Zusammenschlüssen, für die es eine starke, ruhige Hand brauche. Und dieser Ton, den K. fast die ganze Zeit über bewahrte, stand in scharfem Kontrast zu seinen Flüchen im Frühverkehr. Das fand Ornelia komisch.
„Chill, Alter, Hektik ist uncool“, stichelte sie. Es machte ihr Spaß, die Autos und ihre Fahrer zu beobachten, wie sie einander mit Serien von Spurenwechseln zu überholen suchten. Und dann hielt sie nach blonden Jungen Ausschau, die vielleicht so wie sie in die Schule chauffiert wurden. Viele der Wagen und ihre Insassen kannte sie schon und sie dachte sich da gerne Geschichten aus. „Schau Paps, der im blauen Audi dort hat die gleiche giftgrüne Regenjacke wie gestern an, dabei scheint heute die Sonne. Ob der bei seiner Freundin geschlafen hat?“ K. war stolz auf die detektivischen Schlüsse seiner Jüngsten, doch solche Dinge zu diskutieren hatte er keine Lust, er fühlte sich dann gar unbehaglich. Für ihn gab es seine Arbeit bei „Top Rating ltd.“, seine Frau, die ihm Ornelia geschenkt hatte, und den Tatort jeden Sonntag-Abend auf ORF2. Ein Leben abseits davon vermochte er sich nicht vorzustellen und wollte es wohl auch nicht.
„Mathe-Übung hast Du?“, fragte K. stattdessen, worauf Ornelia nur ein gelangweiltes Jaja nuschelte. Sie hätte ganz gerne einen Paps mit blauem Audi und giftgrüner Regenjacke gehabt, ihre Mutter fand sie nämlich einfältig und dabei noch dominant. Ornelia verstand nicht, warum ihr Vater diese Frau ertrug und wünschte ihm insgeheim eine Geliebte. Nur konnte sie mit niemandem darüber reden. Ihre Freundinnen meinten dann nur, sie solle doch froh sein, zumindest gäbe es keinen Streit wie bei ihnen zu Hause.
Mit einem Mal ging ein blonder Junge mit seiner Mutter vor ihnen über die Straße. K. musste stark bremsen und war dabei lauthals loszuschimpfen. Da blieben die beiden vor dem Wagen stehen, drehten sich und lächelten K. und Ornelia an. Nein, das war kein Lächeln, es war ein Strahlen, wie es sich Menschen schenken, die einander lieben. Die unbekannte Frau blickte K. gerade ins Gesicht und so war es mit dem Jungen und Ornelia. K. biss sich erst auf die Zunge, lächelte zurück und biss sich dann ein zweites Mal, denn er meinte zu träumen. Ornelia wurde ernst und unsicher, ihre geheimen Wünsche so direkt vor sich zu haben.
K. und Ornelia stiegen aus, das Hupen und den Motorenlärm der vorbeisausenden Autos hörten sie nicht. „Komm!“, „Bist Du aber fesch!“ – „Ja – sehr gern“, „Du auch!“
Was folgte, war das Ding an sich.