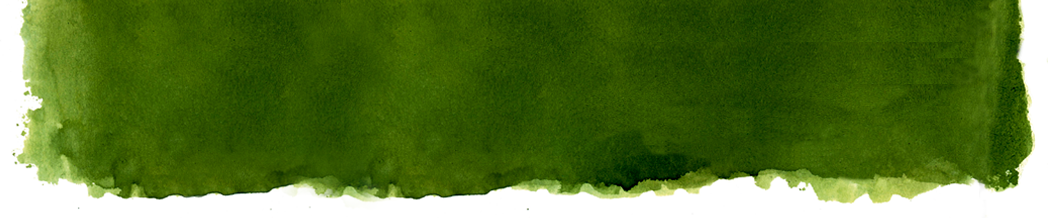E5
Stefan Loicht
Emir war schon eine ganze Weile in seinem etwas zerknörzten und speibfarbenen B-Kadett unterwegs, als sie kurz vorm Walserberg (der ihm immer im Gedächtnis bleiben würde, da dort zwei gelbe Häuser mit den slawisch klingenden, aber nichts bedeutenden Aufschriften „Adatsch“ und „Öamtsch“ standen) im Autoradio – das er sich zusammen mit dem beschädigten Opelblech rundherum vom Lohn, den er während seinem einjährigen Praktikum bei einem süddeutschen Anlagenbauer bekam, kaufte – schon wieder diesen unsäglichen Schlager spielten: irgendwas mit Taiga und Sehnsucht. So grotesk schlecht dieses Lied auch war, unweigerlich weckte es sofort die Erinnerung an Natascha. Natascha, die Studentin der technischen Mathematik aus Omsk. Zwei Jahre ist es nun schon her, dass sie sich bei einer Studienreise zum Traktorenwerk „Ruhmreiche Furche der Sowjetunion“ in Nischni Nowgorod kennen lernten. Emir war sich sicher, sie nie zu vergessen und trotz all der Briefe auch nie wieder zu sehen.
Seine latente Melancholie wurde seitdem nicht weniger, was auch dem Aufenthalt in der Bundesrepublik geschuldet war. Als Sohn eines Eisenbahningenieurs und einer Architektin in einem vergleichsweise noblen Vorort von Sarajevo aufgewachsen, mit der Matura an der Höheren Schule für Maschinenbau in der Tasche und einem sicheren Studienplatz in petto hatte er so gar nichts mit den Gastarbajteri gemein, die sonst zum Broterwerb nach Norden tingelten. Mit Slobodan, dem Laugenschöpfer und Mirko, dem Farbentferner verband Emir nur der Pass, was die deutschen Kollegen halt doch anders sahen. Jugo ist eben Jugo. Es war ein hartes Jahr, aber immerhin hatte er jetzt sein eigenes Westauto und quälte sich in diesem trüben Oktober ´72 gen Süden nach Hause. Die Strecke hieß Europastraße 5 und circa 30 Kilometer hinter Salzburg war dieser Begriff endgültig zu einem Euphemismus geworden.
Die Autobahn hörte abrupt auf und eine Kolonne aus fürchterlich stinkenden Lastwägen, Traktoren und noch schrottreiferen Schwaboschüsseln kroch über einen Pass namens Lueg. Nieselregen und Nebelfetzen machten dieses kollektive automobile Erlebnis zu einem Fest für Misanthropen. Nach Eben im Pongau normalisierten sich die Verhältnisse und die nach Osten führende Ennstalstraße präsentierte sich halbwegs wegbar. Aber als ab Selzthal sich dann am Straßenrand Schilder mit Totenköpfen signifikant häuften, wurde Emir bewusst, dass er sich auf der Gastarbeiterroute befand, jener gefürchteten und in das Herz der Finsternis des Alpenraums führenden Transitstrecke, über die „Der Spiegel“ einige Jahre später titeln würde, dass dort der „Terror von Blech und Blut“ herrsche.
Eine Abfolge von eher grindigen Raststationen, Tankstellen, verdreckten Parkplätzen, wenig vertrauenswürdigen Werkstätten, Kreuzen am Bankett und Ortsdurchfahrten mit rußverschmierten Häuserm, zwischen denen ärmlich aussehende Kinder vergeblich darauf warteten, sicher die Fahrbahn überqueren zu können, prägte die Landschaft. Überladene, untermotorisierte und vermutlich bremsenbefreite Häusln wagten auf der kurvenreichen Straße, deren Oberfläche von Regen, Öl und Benzin düster schimmerte, aberwitzige Überholmanöver. Es graute Emir und er war zerrissen zwischen dem Wunsch, diese Täler so schnell wie möglich hinter sich zu lassen, der Einsicht, dass er langsamer wahrscheinlich eher als ein Ganzer zum Ziel kommen würde und der Notwendigkeit, sich und seinem Opel eine Pause samt Nahrungszufuhr zu gönnen. In Traboch entdeckte er schließlich eine Tankstelle mit angeschlossenem Gasthaus (oder umgekehrt) und überwand sich zu probieren, ob seine paar Deutsche Mark in diesem Gewitterwinkel europäischen Reiseverkehrs als Zahlungsmittel gelten würden, was tatsächlich der Fall war.
Mit dem Restgeld nach dem Tanken ging sich noch eine Mahlzeit aus und Emir betrat erstmals in seinem Leben eine obersteirische Gaststube. So der Kulturschock war das zwar auch nicht, immerhin galten auch in seiner Heimat Pivo und Slivovic als Dinge des täglichen Bedarfs, aber hier ging es doch ein gutes Stück unzivilisierter zu. Spät am Nachmittag war außer der Barbesatzung und den Stammtischbewohnern kaum wer da und so setzte sich Tomislav, der kroatische Kellner zu dem stillen Gast in der Ecke, den er anhand der Zigarettenmarke – Mirko ließ importieren – leicht als Landsmann identifizieren konnte.
Tomislav war dem stets grantigen, aber in seinem Unwillen jeden gleich mies behandelnden Wirten Hans Schlurfbichler eine unverzichtbare Stütze geworden, auch weil sich bei den blockfreien Balkanpendlern herumgesprochen hatte, dass da einer war, der sie verstand; gut fürs Geschäft.
Gute Gespräche verlängern den Abend und Emir nahm Tomis Angebot, auf dem Sofa in seinem Zimmer im Gasthof zu übernachten gerne an. Am nächsten Morgen erklärte der Kroate seine Gastfreundschaft: Er würde gerne bis nach Weihnachten nach Hause fahren, um einige „Dinge" zu erledigen. Nur, wenn er jetzt einfach ginge, bräuchte er dem Schlurfbichler gar nicht wiederzukommen. Keine Eile drängte den Bosnier und so wurde Emir Aushilfsservierkraft. Besonders anstrengend war die Arbeit nicht, es gab Geld für die spätere Weiterfahrt und er lernte rasch, mit den Eigenheiten der lokalen Bevölkerung umzugehen. Die Lauf-, eigentlich Fahrkundschaft, war auch nicht besonders kompliziert. Meistens handelte es sich um Fernfahrer, die alle unter Fernfahrerdrogen zu stehen schienen: wortkarg, leerer Blick und nervöse Füße. Die paar wenigen auftauchenden Jugoslawen hatte Emir mit seinem jugendlichen Charme im Griff.
Ein mangelndes Gut an diesem Ort war Stille. Ein ständiges Dröhnen und Brummelln (eine Mischung aus Brummen und Rollen) lag in der Luft, gewürzt mit den dopplereffektiven Geräuschen, die durchgerostete Auspuffrohre machen. Dazu die olfaktorisch wahrnehmbaren Miasmen der Abgase, aus übergelaufenen Dieseltanks und von abgebrannten Kupplungen. Emir fing an, die Trabocher und ihre Nachbarn zu bedauern. Und dann brach eine Woche vor Weihnachten die Hölle aus. Schneefall setzte ein, die Straße wurde noch rutschiger und statt etwa 10 000 fuhren pro Tag bis zu 40 000 Autos durch das Dorf. Die meisten mit bundesdeutschen Kennzeichen, vollgepackt mit Menschen und Zeugs, die Dachgalerien betürmt. In kleinen Konvois waren abertausende Gastarbeiter auf der Durchreise; vor allem die Türken reisten nur durch. Während die einen oder anderen Südbalkanesen Halt und Rast machten, schienen die meisten türkischen Familien einen Weltrekord im Daueraufenthalten in geschlossenen, sich bewegenden Räumen aufstellen zu wollen (1974 gab es einen Stau von Spielfeld bis Graz: 70 Kilometer, 30 Stunden; fünf Jahre zuvor musste das Bundesheer mit Panzern ausrücken, um das Chaos vor der Grenze aufzuräumen). Unfälle passierten fast im Minutentakt. Die Straßenränder waren zugemüllt und vollgeschissen, manchmal sogar beides, da es nicht wenige gab, die wegen der Pausenvermeidung in Säcke gackten und die dann aus dem Fenster warfen. Emir war fassungslos.
Ähnlich schnell wie die Flut zuvor stieg, kam die Ebbe zurück und der Weihnachtsfrieden legte sich über die Hauptkampflinie des europäischen Transitverkehrs. Anders als der vorangegangene Tsunami brandeten die Rückreisewellen rund um Dreikönig beständig, aber nicht überschwemmend an die steirischen Küsten. Und Tomislav kehrte wieder (er erzählte gleich den alten Witz, wonach der österreichische Zöllner die beiden Jugos fragt: „Gherts es zsamm?“ und der eine antwortet: „Na, er kehrt, I Polier.“). Das Dauerpublikum hatte sich an Emir gewöhnt und ihn auch ein bisschen liebgewonnen, weswegen es eine kleine Abschiedsfeier gab, bei der sogar der Schlurfbichler Anflüge von Freundlichkeit zeigte. Im Laufe des Abends wurde Emir von einem der Stammgäste, kein harter Trinker, sondern einer von denen, die immer spät und schweigsam ihr Bier am Tresen nahmen, angesprochen. Leopold Kraxnberger war sein Name und er betrieb den örtlichen Abschleppdienst samt Werkstatt und Autoverwertung.
Sein Sohn wäre noch bis knapp nach Ostern beim Präsenzdienst und nachdem er von Emirs Ausbildung erfahren hatte, wollte er fragen, ob sich der junge Bosnier vorstellen könnte, noch ein paar Wochen zu bleiben, um bei ihm auszuhelfen. Der Winter ist da wie dort kalt und am Kadett war auch genug rumzuschrauben, also wurden sie einig. Der Poidl war ein guter Kerl, der Emir nicht ins kalte Wasser warf. Am Anfang hatte er nur Werkstattdienst, wo er die angelieferten Autos entweder schnell wieder in Gang brachte – leere Batterien, verschmutzte Vergaser, Patschen, gerissene Keilriemen und so Sachen – oder zerstörte Fahrzeuge mit Blick auf noch brauchbare Teile ausschlachtete. Nach der Eingewöhnungsphase nahm ihn Kraxnberger zu den ersten Abschleppeinsätzen mit, wobei er darauf achtete, dass es eher herkömmliche Unfälle und allenfalls mit Leichtverletzten waren.
Dazu muss man wissen, dass Traboch genau zwischen den gefährlichsten Abschnitten der damaligen Gastarbeiterroute liegt: dem Schoberpass und der Umfahrung Leoben (halt bevor die Autobahn gebaut wurde). Kritisch war vor allem die Rampe zum Massenbergtunnel: dreispurig, zwei davon bergan. Überholt wurde auch auf der dritten, der Gegenspur, so dass die aus dem Tunnel Kommenden oft mit Gegenverkehr rechnen mussten. Von 1970 -73 registrierte die Polizei allein im Stadtgebiet Leoben 2930 Unfälle mit 1291 Verletzten und 67 Toten. Die damaligen Autokonstruktionen taten zusammen mit dem fahrerischen Unvermögen vor allem derer, die erst im Ausland den Führerschein machten das Übrige: starre Rahmen mit starren Karosserien und starren Lenksäulen, keine Gurte, keine Kindersicherungen, unterirdische Verzögerungswerte, indiskutable Leistungsgewichte. Es gibt belegte Geschichten von Leuten, die die Kabel von mitzubringenden Haushaltsgeräten als Schneekettenersatz verwendeten, von einem, der wegen Übermüdung einen Ziegelstein aufs Gaspedal legte, von einem, der im Retourgang in der Kolonne mitfuhr, weil das restliche Getriebe hinüber war.
Der erste wirklich schwere Buserer zu dem er unumgänglich kam, war im wieder eskalierenden Osterverkehr und ein Schock für Emir. Ein Ford Taunus steckte im Straßengraben, um einen Telegraphenmast gewickelt. Der Fahrer wurde von der Lenksäule gepfählt, sein halbes Hirn bedeckte das Armaturenbrett, ein Fuß lag neben dem Auto. Emir musste ansatzlos kotzen, wofür der Poidl, dessen Schwermut nun verständlich erschien, weil er ja dauernd sowas sah, durchaus Verständnis hatte. Das Ärgste in Emirs kurzer Karriere als steirische Schlepphilfe war bald danach ein Frontaler auf der Umfahrung: ein Wagen mit drei Gastarbajteri auf dem Weg nach Norden gegen ein Auto mit einer fünfköpfigen türkischen Familie. Bis auf die Mutter waren alle tot, auch die Kinder. Zerfetzt. Sie waren in einem dieser kleinen Konvois im großen Treck der Verdammten unterwegs. Das funktionierte immer so, dass wenn der Erste überholte, der Rest folgte, egal wie. Nachdem die Mutter von den Sanitätern erstversorgt wurde, schnappte sie jemand aus dem Geleitzug, steckte sie in eines der Autos und weg waren sie. Ihre Familie wurde auf der vor einiger Zeit extra für die Straßenopfer eingerichteten muslimischen Abteilung des Friedhofs beim Krankenhaus Kalwang begraben.
Emir saß im Abschleppwagen und war angesichts der erlebten Verrohung und Abgestumpftheit von unendlicher Leere und Traurigkeit. Im Autoradio spielten sie das Lied von der Sehnsucht und der Taiga. Ach, Natascha. Und plötzlich begriff er, dass es nicht um Natascha ging. Die Sehnsucht, von der da gesungen wurde, hatte nichts mit einem konkreten Menschen zu tun. Es ging um das, warum diese Suizidkommandos auf dieser Strasse unterwegs waren. Das waren alles Menschen, die nicht wussten, wo sie hingehören. Jedes Mal, wenn sie sich auf die Reise machten, glaubten sie sich dem Ziel ihrer Träume näher: entweder im goldenen Westen oder in der mythischen Heimat. Aber nirgendwo konnten sie ruhen. Gerade das Fahren versetzte sie in den Zustand der Bestimmung, die sie sonst nicht hatten. Kaum angekommen, wurde für die Rückfahrt – egal in welche Richtung – geplant. Die Taiga, der Sehnsuchtsort, war gleichermaßen das karge Hochland mit Ziegen und Großfamilien wie der Wandverbau, der Fernseher und der Couchtisch mit Fliesen in Bochum, Bottrop oder Castrop-Rauxel. Der Antrieb, mehrmals im Jahr die Höllenfahrt über dreieinhalbtausend oder mehr Kilometer zu unternehmen, war die Hoffnung auf, ja, auf was eigentlich? Darauf, ein Paria der Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft zu sein? Darauf, dort fremd zu sein, wo man herkommt? Es ist die Hoffnung auf einen eigenen Weg, dachte Emir bei sich und dass jeder einzelne Teilnehmer dieser barbarisch anmutenden Völkerwanderung das Recht auf seine eigene Taiga hat, auch wenn sie nur ein Trugbild im blendenden Fernlicht eines Geisterfahrers ist.
Der Frühling zog ins Land, Kraxnberger junior rüstete ab und Emir fuhr nach Hause. Er ging anders als er kam und das wusste er. Er hatte mehr Blutbäder gesehen als er vertragen konnte und daher war es kein Wunder, dass er 19 Jahre später einer der ersten war, die aus Bosnien flohen. Mit den zwei Kindern und seiner Frau Natascha (das ist eine andere Geschichte, die eine eigene Geschichte wert wäre, nur soviel: es hat etwas mit einem Onkel im diplomatischen Dienst - der 1944 bei den Partisanen Tito vor einem Verrat bewahrte - und einer geheimnisvollen Agentin namens Milada zu tun) trieb er instinktiv und ohne Karte den Yugo-Golf bis Traboch, läutete an der offensichtlich schon stillgelegten Kraxnbergerschen Werkstatt und wurde von dem dennoch öffnenden Poidl ohne zu zögern und wortlos wie ein verlorener Sohn umarmt.
Viele konnten sich noch an den jungen Bosnier erinnern und die kleine Familie wurde, soweit es dem autochthonen obersteirischen Menschenschlag überhaupt möglich ist, herzlich aufgenommen. Poidl stellte ihnen das leerstehende Haus seiner Eltern (das er ihm später sogar vererben würde) zur Verfügung und Emir fand eine Anstellung beim Ausbau der Pyhrnautobahn (mit deren Durchgängigkeit und in Zusammenhang mit der Öffnung des Ostblocks und dem Zerfall Jugoslawiens ironischerweise die alte Gastarbeiterroute endgültig obsolet wurde).
Emirs Reisen schienen zu Ende zu gehen, aber es blieb noch was zu tun. Er schloss sich einer Gruppe von Leuten an, die sich zum Ziel setzten, die denkmalgeschützte Badlwandgalerie vor dem Verfall zu retten. Das ist ein überaus interessantes Infrastrukturbauwerk bei Peggau zwischen Bruck und Graz: Im Zuge des Baus der Südbahn wurden die Geleise auf der ehemaligen Reichsstraße verlegt und darüber eine Steinschlaggalerie errichtet. Wiederum auf dieser verlief sodann die Straße. Bis 1972 wurde der gesamte Individualverkehr über die 1844 eröffnete Galerie abgewickelt. Nachdem in den sechziger Jahren die Bahn ans andere Murufer verlegt und die Schienen wieder entfernt waren, entflechtete man die Ströme, indem nach Norden weiterhin über das altehrwürdige und aus der Zeit vor dem Bau der Semmeringbahn stammende Konstrukt, nach Süden auf der ehemaligen Eisenbahntrasse gefahren wurde. 1978 wurde der oben liegende Teil der Brucker Ersatzstraße endgültig gesperrt und seit Eröffnung der neuen Schnellstraße ist auch unten fast gar nix mehr los.
Diese ehrenamtliche, handwerkliche Arbeit an der mittlerweile teilweise eingestürzten Badlwandgalerie wurde für Emir gleichermaßen ein Dienst zum Gedenken an die Menschen seiner Heimat, die zwar die Fahrten durch die Ostalpen überstanden, um später aber im Krieg alles zu verlieren wie auch an jene, die, egal woher sie kamen oder stammten und wohin sie auch wollten, auf der Gastarbeiterroute ihr Glück, ihre Zuversicht oder ihr Leben ließen. Wobei er, und das zauberte hin und wieder ein Lächeln auf sein Gesicht, nicht weniger derer gedachte, denen die mörderische Transitstrecke schließlich nur eine Etappe auf der Fahrt in eine bessere Zukunft, wo immer sie sie finden würden, war.
Die Kinder sind schon längst woanders und manchmal sitzen Natascha und Emir an den trüben Herbstabenden im Wintergarten unweit einer geschlossenen Werkstatt mit verblassendem Schild und einem seit einigen Jahren einer serbischen Familie gehörenden Gasthaus mit angeschlossener Tankstelle (oder umgekehrt), blicken auf die nunmehr fast verkehrslose ehemalige Europastraße 5, sinnieren über die Wege ihres Seins, betrinken sich gemütlich und ohne Vorsatz, sind traurig und glücklich ob all ihrer Verluste und Gewinne, weinen deswegen ein bisschen und spielen dazu das alte Lied der Taiga.