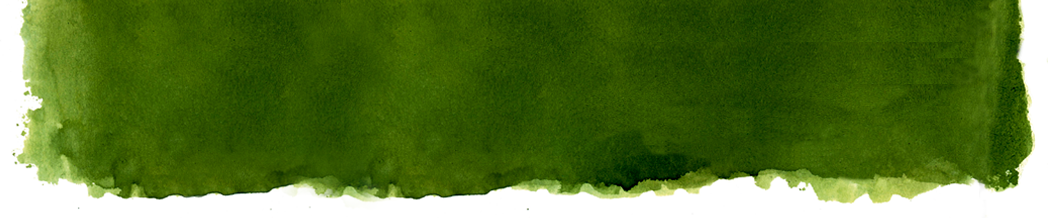Rufus D. aus W. : Freitags De-/Impressionen...
Michael Drucker
Selten werde ich so platt auf die Banalität meines Daseins gestoßen wie morgens am Freitag. Mein Radiowecker plärrt so wie immer, aber der Moderator schwört seine verehrten Hörer an diesem speziellen Tag immer auf das Wochendende ein. Eigentlich geht die Leier schon am Mittwoch los, Tage zählen bis zum Allerheiligsten. Wie die Striche an der Wand einer Gefängniszelle kommt mir das vor, oder wie es die katholische Kirche die Gläubigen gelehrt hat: der Lohn für das irdische Leid ist das Himmelreich. Gleichsam ist das Wochende die Erlösung vom Leid der arbeitenden Bevölkerung, der Arbeitswoche. Für fünf Tage Hölle werden wir mit zwei Tagen Himmel belohnt. Also ich halte die Vorstellung nicht wirklich aus, so einfach fünf Siebentel meines Lebens als öd und sinnlos zu sehen, abgesehen von der Notwendigkeit natürlich, mich und meine Familie zu ernähren. Diese Geisteshaltung, die der Kerl da über den Äther verbreitet, macht uns demütig und gefügig, so wie es früher auch die Aufgabe der Priester war, das gemeine Volk ruhig zu stellen, damit es brav seine Arbeit für den irdischen Herrn verrichtet. Kommt eh irgendwann der Himmel, respektive das Wochenende.
Und das Schlimmste an diesen Freitagen ist, dass es mir oft genauso geht. Ich freue mich darauf zwei verdammte Tage nicht Arbeiten zu müssen. Punktlandung! Ich bin keinen Deut besser als das restliche Radiohörervolk.
Nur – ich freue mich aber meistens nicht auf das Wochende, ich mag nämlich nicht in dem Bewusstsein nur zwei Tage zur Verfügung zu haben, all die Dinge rasch erledigen, die sich unter der Woche aufgestaut haben, nicht einkaufen, aufräumen, Sachen reparieren, nicht Bekannte zum Essen einladen, die man schon sooo lange nicht gesehen hat, ich will keinen Sport machen, obwohl in meinem Alter, es ist ja so wichtig sich zu bewegen, gerade in meinem Alter, nein, auch keine Texte für Dichterkampflesewettbewerbe schreiben, ich will nämlich gar keine Texte schreiben, wollte ich schon in der Schule nicht, ich will nicht auf den Fußplatz und den Tratsch der anderen Fußballeltern anhören, nein, ich will das alles nicht.
Und dann kommt sie, die Erkenntnis. Die Wochenendjünger sind
ja richtig die Helden, du selbst nämlich verscheißt gerade die vollen sieben Siebentel deines Lebens, oder?
Mit solch verheißungsvollen Gedanken beseelt, besteige ich dann an einem Freitag Morgen, egal ob trüb oder sonnig, die U-Bahn. Wird sicher noch toller letzter Arbeitstag für diese Woche, ich sollte lieber gleich auf ein Bier gehen...
„Mein Name ist Karl Di Abbanotta, ja richtig, Karl, nicht etwa Carlo. Ich bin Wiener, mein Vater war aber Italiener. Er kam wie viele andere aus dem Friaul herauf nach Wien in die Hauptstadt, vor dem Krieg war das noch. Ich weiß nicht genau, wie lange das her ist, ich weiß eigentlich auch gerade gar nicht, wie alt ich eigentlich selbst bin oder wo ich eigentlich bin. Ja, ja, das Alter. Mein Vater handelte mit Zinnwaren, zuerst als fahrender Händler, zum Schluss hatte er dann sogar ein eigenes kleines Geschäft im siebenten Bezirk. „Cazza“ haben s‘ g‘heißen, die großen eckigen Zinnlöffeln aus Oberitalien, die wir Italiener in der ganzen Monarchie verkauft haben. D‘rum haben s‘ uns auch die „Katzelmacher“ g‘nannt. Mein‘ Vater auch noch, bei mir hat man ‚s nimmer g‘hört bei der Sprach‘...
...Ja schau, wer ist dann da g‘rad‘ rein‘kommen ins Zimmer, a Schwester und was für a liabe, na die schaut ja richtig adrett aus. „Herr Abbanotta! Freitag ist, Sie kommen wieder zur Dialyse, der Krankenwagen ist schon da!“ plärrt s‘ mich an. Sie kommt zu mir her, diese Schönheit, und deckt mich ab. Wenn mir so ein Frauenzimmer die Decke wegzieht, da muss ich ihr auf den Allerwertesten greifen, da kann ich gar ned anders. „Hör‘n s‘ auf Sie, Sie,..., a geh...“, regt sie sich auf und stößt meine Hand reflexartig weg. Sofort entschuldigt sie sich, fragt, ob eh alles in Ordnung ist, nimmt meine Hand wieder und wirft einen prüfenden Blick darauf. Sie wendet sich den Sanitätern zu, die da plötzlich bei ihr stehen: „Bei dem müßt‘s gut aufpassen, nicht zu fest anpacken, der hat Glasknochen, der hat sofort was gebrochen, letzte Woche haben s‘ ihm sogar die Schulter ‚brochen beim Auf die Trage Legen“...
„...Das ist doch nicht unsere Wohnung, die kleine Wohnung über‘m G‘schäft in der Kaiserstrasse. Wo bin ich denn? Neben mir steht ein Frauenzimmer, ein recht ein fesches. Und was die anhat, da sieht man ja die Haxen bis zum Knie. Ein so ein Flitscherl! Ich greif‘ ihr auf den Hintern. „Herr Di Abbanotta, jetzt lassen s‘ das, ein für alle Mal!“ schimpft s‘ mit mir. Sie geht einen Schritt auf die Seite und ich komm nimmer hin. Ich will mich aufsetzen, aber es geht nicht, ich will mich zur Seite drehen – geht auch nicht, was ist mit mir?
Ich heiße Karl Di Abbanotta, meine Freund‘ ham immer Carlo zu mir g‘sagt, wenn s‘ mich ärgern wollten, zu an „Katzelmacher passt des halt besser. Mich hat‘s aber nie g‘stört...
Und bei den Weibern, ich sag‘ ihnen, da war mein italienischer Name nie zu meinem Nachteil....
Ich will nur wissen, wo ich da jetzt bin, ist das gar ein Spital? Und was ist mit mir, den Kopf kann ich ned heben, ich kann mich selbst nicht sehen, was ist da los?
Zwei Uniformierte in einer schiachen Uniform kommen und heben mich sanft und vorsichtig auf ein G‘stell ein komisches, schaut aus wie eine Tragbahre auf an Leiterwagerl...
Na des werden die Engerl sein, die mich abholen, kane wichtigen mit dera Uniform san s‘ ned. Aber Geld, dass ma uns was Gott was leisten hätten können, hamma eh nie g‘hobt, jetzt kommen halt zum Schluss a nur die billigeren Engeln.
Mein Name ist Karl Di Abbanotta, nicht Carlo, wirklich Karl. Muss ich alles beichten, dort wo s‘ mich jetzt hinbringen? Ich sag ihnen ein ganz Braver war ich nie, aber was ganz Schlimmes war auch nie dabei, Ich wollt halt immer mein Spass haben, versteh‘n S‘ und den hab ich g‘habt, aber nix Arges ned, versteh‘n S‘...“
Die U-Bahn ist am Stephansplatz angekommen und ich dränge mich gemeinsam mit den freitäglichen Morgenmassen weiter zur U1.
Kennen sie das eigentlich auch? Wenn man auf einen Menschen trifft, der einem irgendwie unheimlich ist, den man nicht versteht, der anders funktioniert als die vermeintliche Norm, dann reagiert man erst überrascht, distanziert, vorsichtigt. Ich werde aber immer gleich neugierig und versuche in meiner Phantasie, mich und alles um mich herum durch die Augen dieses Menschen zu betrachten, male mir aus, was und wie er denkt über das was er wahrnimmt. Und diese Momente bleiben mir dann in Erinnerung, so wie eben, als ich tagträumend in der U-Bahn saß. Ich war damals an diesem Freitag einer der beiden Sanitäter, die den alten Herrn Di Abbanotta zur Dialyse ins Kaiser Franz-Josef Spital führten. Er lag hinten im Krankwagen und erzählte mir die ganze Fahrt lang in einer Dauerschleife von seinen Schelmereien und den Mäderln. Er hatte unheimlich Spass dabei, manchmal lachte er soger ein wenig. Manchmal, wenn er mich wieder für den uniformierten Engel hielt, hatten seine Worte eher den Charakter einer schelmischen Beichte. Er lag da, fast bewegungsunfähig, abgemagert, hatte Glasknochen und eine gebrochene Schulter, musste zur Blutwäsche, aber er hatte sichtlich Spaß. Wenn ich ihn unterbrach, um eine Frage zu stellen, riss bei ihm meistens der Faden und er begann sich wieder vorzustellen: „Mein Name ist Karl Di Abbanotta, und so weiter...“. Also hörte ich auf Fragen zu stellen und hörte nur mehr zu.
Seine Schulter würde nicht mehr operiert, das geht in seinem Zustand nicht mehr, hatte mir die Schwester erklärt. „Das muss nicht Alzheimer gewesen sein“, erklärte mir ein befreundeter Arzt, „meistens stellen sie die schweren geriatrischen Fälle mit starken Mitteln ruhig, dann fallen sie ihnen weniger oft aus dem Bett, sind überhaupt leichter zu pflegen, macht es einfacher für das Personal...“. Egal, was es war und warum er so war – jedenfalls blieben da noch seine Augen, und die wirkten irgendwie hell und wach, ja unglaublicherweise froh und glücklich, ignorierten die Lage, in der sich der Körper, dem sie anhafteten, befand völlig. Diese Augen waren die gleichen jungen Augen, die damals im Wien der Zwischkriegszeit offensichtlich reihenweise Mädchenherzen zum Erliegen gebracht hatten. Wir lieferten ihn auf der Dialysestation ab...
Das Wetter ist richtig mies, als ich am Schwedenplatz wieder Tages- licht erblicke. Ich tue es den Leuten um mich herum gleich und versuche nicht in die Lacken zu treten, die der heftige Regenschauer schon gebildet hat. Die vorbeifahrenden Autos am Kai schleudern den Wartenden vor der Fußgängerampel mächtige Fontänen ent-gegen, daher warten alle circa zwei Meter weiter hinten als sonst. Die hintersten Wartenden stehen dadurch schon auf den Geleisen der Straßenbahn und werden auch schon von einer herannahenden
1er Garnitur durch lautes und aggressives Bimmeln weggescheucht. Einige drängen nach vor in die Menge und schieben dadurch die Vordersten in den Spritzbereich der Autos. Ich versinke wieder in Gedanken...
Können sie sich noch an die Zeitungskolporteure erinnern, die an jeder größeren Kreuzung der Stadt postiert waren, um den wartenden Autofahreren ihr „Krone, Kurier“ entgegenzurufen? Dumme Frage, natürlich können sie. Ich arbeitete damals südlich von Wien und staute mich mit dem Auto azyklisch zu den Pendlern trotzdem täglich aus Wien raus oder nach Wien rein. An der Kreuzung Gablenzgasse-Schmelz war zu dieser Zeit ein besonders emsiger Zeitungsverkäufer heimisch. Hemmungslos lachte er die griesgrämig im Stau stehenden Autofahrer an. Einmal sprach er mich durchs offene Fenster an, wünschte mir einen guten Abend, und fragte natürlich ob ich Krone, Kurier wolle. „Nein, Danke, ich lese nur den Standard“ gab ich zur Antwort. Er zuckte ein wenig fragend mit den dichten, dunklen Augenbrauen, sagte „Hab nicht“ und wandte sich meinem Hintermann zu. Am nächsten Tag erkannte er schon von Weitem mein Auto, was mir per se schon ein Rätsel war, wie man sich bei dem täglichen Aufkommen ein einzelnes Auto merken konnte, zumal ich ja keinen Jaguar E sondern einen alten „Einser“ Passat fuhr. Er klopfte Freude strahlend an mein Fenster, ich öffnete und er hielt mir einen Standard herein. „Zehn“ sagte er und hielt die Hand auf. Ich war mir nicht sicher, aber ich glaube der Marktpreis für eine Standard war damals neun Schilling. Der Aufschlag war für ihn offensichtlich völlig selbstverständlich, für‘s extra Besorgen und für‘s Merken des Autos. Ich war sowieso überrumpelt und so fand das Geschäft also statt. Die nächsten Tage galt es, einen Deal zwischen uns zu finden, mit dem wir beide leben konnten, ich hatte nicht vor, täglich eine Zeitung zu kaufen, schon gar nicht um einen Schilling teurer als überall anders, er wollte aber für seine Leistung den Standard an die Schmelz zu bringen, mit einer Art Abonnement belohnt werden, das ich bei ihm einzulösen hätte. Der Kompromiss hieß dann einmal pro Woche die Samstag Abendausgabe, also die, die man Freitag Abend schon bekommt. Wegen dem Kreuzworträtsel hätte ich die ohnehin gekauft. Und zum Marktpreis natürlich, das war meine Bedingung. Unsere Ge- schäftsbeziehung hielt über den ganzen Sommer, bis in den späten Herbst. Der Stau auf der Johnstrasse an diesem saukalten, verregneten Freitag war länger und das Vorwärtskommen war auch noch einmal langsamer als sonst. Oben auf der Schmelz wurde es einspurig, Einsatzfahrzeuge blockierten den linken Fahrstreifen, ein Polzist wies wild gestikulierend die Autofahrer in der Kolonne zum Vorbeifahren an. Der Regen war in der Zwischenzeit zum Schneeregen geworden. Ich wusste augenblicklich, wer da lag am nassen Asphalt, seine Leiche notdürftig überdeckt, daneben ein riesieger, verwaschener, sich mit den Lacken vermischender Blutfleck, dessen Quelle bereits versiegt war. Sein roter Krone-Anorak war am Arm, der unter der Decke herausragte teilweise noch erkennbar. Überall verteilt klebten aufgeweichte Zeitungen am Boden. Durch seine Augen konnte ich die Welt nun nicht mehr betrachten, denn die sahen nichts mehr. Ohne irgendwas über ihn zu wissen, begann ich mir die Unstimmigkeit dieses Bildes auszumalen. Er war wohl irgendwo in Ägypten großgeworden, seine Familie, die er von hier aus mit seinem kärglichen Lohn versorgte, hatte er irgendwo dort im warmen, sonnigen Süden. Seine fröhliche, ein wenig aufdringliche Art gehörte dorthin. Sein Ende hier in den kalten Lacken, zwischen griesgrämigen Polizisten liegend und durch griesgrämige, durch den Stau genervte Autfahrer flankiert, passte nicht in das Bild. Ich überwand den Drang stehen zu bleiben und die aufgeweichten Reste meines Standard aufzulesen, über die sich die Kolonne hinwegwälzte, ihm sein letzten Umsatz in die herausragende Hand zu drücken und fuhr heim, ins Wochende.
In der Zwischenzeit ist es Freitag Nachmittag geworden, das Groß- raumbüro leert sich zusehends und wirkt eine leere Konzerthalle nach dem Konzert. Ich liebe diese Stimmung, mache meine Arbeit zu Ende. Die Putzfrauen, in ihrer grünen Uniform, übernehmen das Kommando, eine pro Stockwerk. Andere Dinge als „Geschäfte machen“ gewinnen hier damit plötzlich an Bedeutung. Die Putzkolonne wird von einer älteren Frau, vermutlich eine Serbin, kommandiert. Sie herrscht über alle Stockwerke, ihre Uniform ist anders, ist weiß. Und ich will bei Gott nicht unter ihr dienen müssen. Sie schreit völlig ungehemmt mit ihren Untergeben herum, ich vermute in der Putzkammer werden sie vermutlich auch geschlagen und gefoltert. Sie ist ein richtiger Drache.
Heute übertreibt sie es. Sergeant P. aus Full Metal Jacket wäre echt ein Frühlingslüfterl gegen sie. Vermutlich hat sie nicht bemerkt, dass noch jemand da ist, und plärrt, als gebe es kein Morgen. Irgendwas muss meine arme, kleine Putze hier im neunten Stock wohl falsch gemacht haben.
Mir reichts, ich stehe auf, gehe um die Ecke und ersuche sie höflich, aber bestimmt um etwas Zurückhaltung, immerhin würde ich noch gerne meine Arbeit fertigstellen und nicht ihrer schrillen, überschlagenden Stimme lauschen. Das wirkt gut. Die Autorität der Krawatten-tragend Büromänner über die niedere Putzfrauenkaste ist in ihrem Gehirn offensichtlich fest verwurzelt. Der Drache entschuldigt sich unterwürfig, buckelt fast sklavisch vor mir. Die Gedemütigte, eine junge, nicht unhübsche, kleine Frau, wohl ebenfalls aus Serbien, steht daneben und genießt ihrerseits die Demontage ihrer Peinigerin. Unsere Blicke treffen sich, in ihrem liegt Dankbarkeit und ein wenig Ehrfurcht, irgendwie bin ich ungewollt zu ihrem Drachentöter geworden. Der gezähmte Drache gibt ruhig noch ein paar Anweisungen und dampft ab zur Liftlobby, um im nächsten Stock wieder Feuer zu speien.
Und ich habe jetzt eine Beziehung zu meiner Stockwerks-Putzfrau. Also nichts Falsches dabei denken bitte, ich meine lediglich, wenn man sich grüßt an etwas gemeinsam Erlebtes zu denken, zu wissen, dass der andere auch daran denkt. Wir sprechen sonst nichts, halten uns akribisch an die Regel: Kein Austausch zwischen der Krawatten-Träger-Kaste und der Putzfrauen-Kaste!
Irgendwann, Wochen später, fällt mir auf, das eine Neue den neunten Stock übernommen hat.
Ich treffe zufällig beim Rauchen im Hof auf den Drachen. „Was ist eigentlich mit der Frau vom neunten Stock, Urlaub?“ frage ich sie. „Weißt du nicht?“ sie sieht mich groß an, auch der Drache und ich haben eine Beziehung seit damals, „ Jena tot, erschlagen....!“
Damit rechnest du nicht, so im Nebenbei. Ich dämpfe die Zigarette aus und gehe wieder zurück zu meinem Schreibtisch. Das Internet liefert nach kurzer Recherche die Geschichte ihres Endes: Ottakringer Straße, Balkanmeile, Eifersuchtsdrama, eine Tote, der vermeintliche Nebenbuhler verletzt, der Lebensgefährte ist geständig, letzten Freitag Nacht..., Jelena P. schlug unglücklich mit dem Kopf auf, nachdem er..., verstarb zwei Tage später im Krankenhaus,...
Die Ottakringer Straße also, Freitag des nächtens immer bevölkert, Stimmung, BMWs aus deren Subwoofern die Schlagermusik der Heimat klingt, die Buben besoffen, die Mädels leicht bekleidet, voller Emotionen, zwischen Freude, Trauer und Aggression.
Herrn Di Abbanotta mussten wir damals nicht mehr zurück ins Pflegeheim bringen. Der Transport wurde abgesagt. Verstorben auf der Dialysestation, erzählte mir damals nach Dienst ein befreundeter Disponent vom Journaldienst.
Ich fahre den Rechner herunter und mache mich auf den Heimweg. Durch die leeren Hallen, hinaus durch die Sicherheitstüren des Rechenzentrums.
Wussten sie das? Wenn eine Bank, so groß wie die, bei der ich arbeite, einmal zugrunde geht, einmal abgeschalten werden müßte, so wie die Lebenserhaltenden Maschinen von Jena oder Herrn Di Abbanotta, dann kann es nur an einem Freitag sein – wegen der Endverarbeitung der Buchungswoche, nur die ergibt einen konsistenten Datenstand im System, macht eine Schlussbilanz möglich.
Freitag Nacht. Ende der technischen Verarbeitungsläufe. Der letzte dreht die Server ab! Ende! Wochenende!