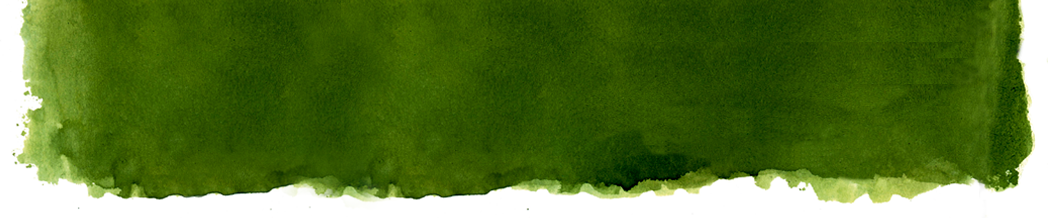72 Jungfrauen
72 Jungfrauen
von Bernhard Mitterer
Er war nun schon einige Tage hier auf Fortunada. Einer kleinen Insel im Nirgendwo. Obwohl, nirgendwo stimmte nicht ganz, auch wenn es den Anschein hatte. Die Insel lag weit ab der Zivilisation, in jeder Himmelsrichtung dauerte es mindestens zwei Wochen, biss man das nächste Festland nur zu Augen bekam. In Nördlicher Richtung gab es die meiste Zeit jedes Jahres schnelle Wetterumschünge, die auch die Gezeiten beeinflussten. Dies trug nicht sonderlich bei, ein Schiff von nördlicher Richtung aus nach Fortado zu bringen. Südlich befanden sich die Eismeere, die sowieso keiner nicht befuhr. Es gab dort weniger als auf Fortado. Aus dem Westen und dem Osten war es einfacher, die Insel zu erreichen, aber wie ich schon erwähnte, aufgrund der langen Fahrt schien es sinnlos ein Insel aunzusteuern, auf der es praktisch nichts gab, was es irgendwo anders nicht einfacher zu erreichen gab. Somit verirrten sich nur wenige hierher auf Fortado.
Fortado war eine kleine Insel, knapp eine Fusstagessreise lang und in etwa die Hälfte breit. Sie hatte nicht viel zu bieten, außer die Früchte die sie selbst trug. Trinkwasser gab es auch. Es kam aus dem Berg, der das Zentrum der Insel bildete. Im Grunde war die Insel auch nur ein Berg, zum Glück flachte es aber an den Seiten ziemlich schnell ab, was es möglich machte, sich am Rand niederzulassen, und etwas aufzubauen, wenn man das wollte. Zum Beispiel eine kleine Anlegestelle mit Lagerhaus. Es könnten sich ja doch Leute hierher verirren. Und sollte dies tatsächlichen einmal passieren, dann kann ein wenig „ausländischer“ Proviant nicht schaden. Ein wenig Rum, Zucker und noch einige Sachen, die einem auf See ausgehen könnten. Eventuell noch eine Wirtsstube, wo sich die Matrosen in geselliger Runde den Wanst vollschlagen können, ohne Angst vor Schlangen, die sich in deine Hose schleichen. Ohne Angst, vor Spinnen oder anderem Getier, das dich Deinen Grog nur mit aüßerster Vorsicht genießen lässt.
Alles in Allem nur Hirngespinst, im Grunde genommen gab es keinen Grund auf diese Insel zu kommen. Wasser gab es zuhause in Mengen. Früchte konnte man am Markt am Sonntag kaufen. Manchmal bekam man auch ein Stück Schweinefleisch zu einem halbwegs angemessenen Preis. Gesellige Runden mit Freunden gab es zu Hauf und wenn du woanders warst, gab es eine Menge Leute, mit denen du auf einen oder mehrere Krüge losziehen konntest.
Hier gab es nichts, wofür es sich wirklich lohnte, auch nur im entferntesten daran zu denken, die Anstrengungen zu unternehmen um hierher zu gelangen. Weil es hier nicht gab außer Bäume und Felsen, Früchte und Wasser und den Ausblick auf noch mehr Wasser. Aber Fortado hat und das weiß im Normalfall nur ein Mensch, 72 Jungfrauen. Ich weiß es nun auch.
Geboren wurde ich nicht wie normale Kinder auf dem Festland, behütet von Hebammen und versorgt von Männern der Wissenschaft des Körpers. Ich wurde nicht in einer Wind und Wetter schutzbietenden Behausung geboren. Mich gebar meine Mutter auf einem Schiff. Das Schiff hatte den Namen „Sekhem“, magischer Wille. Das Wetter war stürmisch, dichte Wolken erhobern sich am Himmel und es war eine dunkle, gefährliche Nacht. Die Götter spickte sie mit Blitzen, so viele als schienen sie die Welt zerbersten zulassen und neu zu formen, um sie von der Menscheit zu reinigen damit diese von ihren Sünden reingewaschen würde´, damit sie neu beginnen konnte. Die Wogen waren hoch, das Schiff wurde gebeutelt von den Wellen, jede einzelene traf das Schiff, als versuchten sie es in zwei zu teilen und in die tiefsten Teifen der Meere zu ziehen. Aber das Schiff hielt stand und wehrte sich. Gerade in dieser Nacht begab es sich, dass ich das Licht der Welt erblickte. Es war alles andere als einfach unter diesen Umständen geboren zu werden. Die Lampen unter Deck schwangen wie wild umher und machten eine Geburt umso schwerer. Das Feuer war schwer am lodern zu halten, von der Gefahr, dass das Schiff in Flammen aufging ganz zu schweigen. Aber dennoch gelang es allen, die dabei waren mich gesund und munter zu empfangen. Das erste,was ich in meinem Leben tat,war das Medaillon meiner Mutter anzufassen, welches ich nach all diesen Jahren, bis heute, noch um meinen Hals trage.
Meine Eltern waren nie dem Festland zugetan, sie waren den Großteil ihres Lebens auf See. Dies begründet sich haupsächlich darauf, dass mein Vater fasziniert war von Mythen und Geschichten über fantastische Dinge. Mit sechzehn zog er bereits in die Welt hinaus und studierte Länder und Zivilisationen. Das Interesse war wahrlich groß und er war so fasziniert von der Welt und seinen Geheimnissen, dass ich ihn als den belehrtesten Menschen auf der ganzen Welt ansehe.
Durch dieses Interesse lernte er auf einer seiner Expeditionen auch meine Mutter kennen. Sie war vom Volk der Teniter. Dieses Volk war sehr sehr weise und hatte eine lange Geschichte, mit vielen Sagen und Erzählungen. Im Laufe des Studiums zeigte sich, das diese Geschichten viele Ähnlichkeiten zu anderen Völkern zeigte, was teilweise auch bedeuten konnte, dass es nicht nur Geschichten und Mythen waren, sondern in vielen Teilen auf Wahrheiten beruhten. Meine Eltern hatten sich währenddessen ineinander verliebt und arbeiteten oft gemeinsam an den Geschichten. In beiden erwachte die Neugier und der Wunsch diese Mythen zu sehen, in die Welt hiauszufahren und diese Geschichten weiter zu ergründen.
So fassten sie den Plan, sich ein Schiff zu bauen, dass den Gefahren standhalten konnte und sie sicher an ihre Ziele bringen konnte. Es dauerte ungefähr zwei Jahre, bis es fertig gestellt wurde, aber dann war die Zeit angebrochen, in See zu stechen und ein stabiles Leben zu velassen. Es war an der Zeit, sich den Abenteuern zu widmen, die sich in ihren Weg stellten und diese zu ergründen.
Ich war nun schon einige Tage hier auf Fortunada. Fortunada, die Insel der Vergessenen. Fortunada, die Insel ohne Zukunft. Fortunada, die Insel mitten im Nirgendwo. Fortunada, die Insel der 72 Jungfrauen.
Im Laufe der Jahre bereisten meine Eltern viele Orte, die sie aus den Geschichten der Teniter kannten. An jedem Ort erfuhren sie weitere Geschichten und Sagen, wundervoll und atemberaubend. Und jede von ihnen führte sie weiter führten in andere Länder. Alle waren sie geheimnisvoll, alle gaben etwas Preis, ob es ein versunkener Schatz war oder verborgene Geheimnisse aus alten Tagen, längst vergessene Wahrsagungen, ob sie nun eintrafen oder nicht. Ein Mysterium, welches meinen Eltern sehr am Herzen lag, womit sich sich am meisten beschäftigten, war das Leben nach dem Tode. Zeitlebens suchten sie nach Geschichten und Erzählungen, die Klarheit bringen sollten. Sie hatten nicht etwa Angst vor dem Tod, nein. Es ging vielmehr darum, die eine Wahrheit darüber zu erfahren, wenn es sie denn auch gab. Eigentlich begonnen hatte diese Suche als mein Vater seine Heimat verlies und in die weite Welt aufbrach. Damals kannte er schon die Mythen der verschiedenen Religionen, zumndest das was sie erzählten. Und das war im Grunde genommen nicht viel, so wie das bei Religionen des Öfteren der Fall ist. Hier und da gibt es einige Hinweise die darauf zeigen, was im Leben nach dem Tode sein. Im Christentum zum Beispiel würde sich zeigen ob wir im Paradies unsere Ruhe finden und fortan glücklich und friedvoll unser zukünftiges Dasein erleben oder die Hölle zu unserem ewigen Spielplatz machen, in der wir all die Sünden, die wir uns zu Lebzeiten anlastenen immer und immer wieder durchspielen würden. Die Ägypter hielten es ähnlich, auch wenn sich die Namen ein wenig unterschieden. Aber im Grunde genommen entschied sich nach einer Prüfung, bei den Ägyptern war es das Wiegen des Herzens, ob derjenige nach Sechet Iaru, dem Paradies, kommen würde oder durch Ammit gerichtet, in Totenreich zu wandeln.
Etwas düsterer waren die Juden mit ihrem Sheol, einem Dasein in der Schattenwelt, fern von Gott und fern jeglicher Erlösung. Über die Jahrhunderte hinweg schien sich ihr Glaube dahingehend zu erweitern, dass es vielleicht doch möglich ist, Reinkarnation zu erreichen und evt. ein neues Leben fristen zu können, doch auf welche Art. Die Vorstellungen der Griechen hatten ebensowenig ein Paradies, wo sich der Mensch nach dem Tode ausruhen könnte und friedlich sein weiteres Dasein erleben konnte. Genasuo düster wie bei den Juden, fristeten sie ihre Existenz in der eiwgen Gegenwart, ohne jegliche Erinnuerung an die Vergangenheit oder Wissen über die Zukunft.
Der Islam hingegen war voll von schönen Dingen. Nach deren Tod würde alle Last des Lebens abfallen. Man würde neben seinem Gott sitzen und jede Herrlichkeit, die man sich nur vorstellen konnte, geniesen. Sei es nu Gold das herab regent oder Wein der wie Bäche den Berg herunter fliest und man nur den Mund zu Boden legen musste, damit man davon trinken konnte. Oder seien es junge Frauen, so schön und zart, das einem die Lenden beim verrichten des Genußes nie müde wurden.
Eines aber hatten alle Geschichten gemein. Es musste irgendwo einen Ort geben, an dem man sich nach dem Tode aufhalten musste, egal ob Himmel oder Hölle. Meine Eltern waren der Meinung, dass es keines von Beiden gab, sie sagten, dass es wohl eher nur einen einzigen Ort gab, an dem sich all die verstorbenen Seelen versammelten und gemeinsam ihre neue Existenz verbrachten. Der Unterschied allein lag in der Sichtweise jedes Einzelenen wie er diese Existenz zu verbringen gedachte. Die Teniter glaubten diese Wahrheit und sie schien von allen Wahrheiten die eine zu sein.
Das Medaillon meiner Mutter. Dieses Medaillon war viele Generationen im Besitz ihrer Familie, meine Mutter sagte sogar, sie hätten es schon seit ihrer Ankunft in der neuen Heimat besessen. Es war etwa so groß, wie die Hand eines erwachsenen Mannes. Das Material, aus dem es gerfertigt war, war unbekannt, zumindest konnte es niemand identifizieren. Es war nicht Gold aber auch nicht Messing, dennoch glänzte es in einer goldenen Farbe und wenn man es länger und genauer betrachete, schein sich der Glanz zu bewegen und die Farben geringfügig zu wechseln. Ein wenig blau, ein wenig grün und auch rot waren im Schimmer vorhanden. Man konnte sich leicht darin verlieren und es stundenlang betrachten und alles um sich herunm vergessen. Es zieht einen in sich hinein, als gäbe es einer andere Welt darin, eine Welt ausendmal schöner als hier draussen. Deshalb trug es meine Mutter meist unter der Kleidung oder bewahrte es in ihrere Tasche auf. Aber niemals gab sie es aus der Hand, außer meinem Vater. Mich lies sie es nur betrachten, aus der Ferne. Die Darstellung war einfach aber genau gearbeitet, wenige Symbole verbanden sich zu einem Mosaik. Eine Sonne, welche in der Mitte erhaben war. Von dieser aus zeigten acht in einem Winkel von etwa 45 grad nebeneinander angeordnete Strahlen nach oben. Am Ende dieser Strahlen führten je neun Punkte weiter nach oben, der mittlere Strahl und seine Punkte waren heruasgehoben und schienen mehr Bedeutung zu haben als die anderen. Den Abschluß bildete ein jeden Strahl umspannender Bogen, der alle miteinander verband. Gebettet waren diese Symbole auf einem symmetrischen sternförmigen Untergrund, der auf der Rückseite denselben Bogen wie auf der Vorderseite eingekerbt hatte.
Man sagte es sei ein Wegweiser zum Urspung ihrer Zivilisation zum Anfang der Reise der Teniter, wo sie einst lebten. Und diese Reise waren sie gegangen, Vater und Mutter. Und sie kamen in den Orient, wo sich all die Mythen trafen, wo all die Geschichten ihren Ursprung hatten. Dies brachte meine Eltern bei ihren Studien eben auch zu den Erzählungen des Islams. Sie waren der Meinung, dieser Geschichte am ehesten folgen zu können. Die Hinweise und die Bilder die sie fanden bestärkten sie in ihren Schlussfolgerungen, dass sie in der Lehre des Islams den Weg ins Paradies finden könnten. Und dabei half ihnen das Medaillon. Es war nicht nur Familienwappen, es nicht nur ein Wegweiser zum Ursprung der Teniter, es war nicht nur ein fantastisches Bild. Nein, es war viel mehr. In einer längst vergessenen Stadt im Orient deren Häuser gerademal noch aus den den untersten Steinen bestand, sollten meine Eltern so nah wie noch nie an das Ziel ihrer Reise kommen. Sie verbrachten Monate an diesem Ort, studierten den ort und seine Geheinmisse, studierten die anliegenden Höhlen, worin sich Malereien befanden, die kaum noch lesbar waren. Aber mit dem Medaillon waren sie in der Lage, viele der Zeichen zu entschlüsseln. Sie schafften es, eine Geschichte niederzuschreiben, wie es sie noch nie gegeben hatte.
Die Möglichkeit einer Lösung so nahe zu sein, lies sie alles um sich vergessen. Sie aßen nicht viel, sahen schon abgemagert aus. Sie schliefen nicht viel und wenn, dann nur ein paar Stunde, gleich neben der Tafel oder der Malerei, die sie gerade untersuchten. Ihre Augen waren blutunterlaufen und wenn ich sie mal zu Gesicht bekam, erschrak ich oft ihrer Ansicht, als wären es Geister die das Licht fürchteten. Sie verzogen sich nach kurzer Zeit wieder in das Licht ihrer Fackeln und dem Schutz der Höhlen. Sie erzählten mir immer weniger, ich verstand immer weniger von dem, was sie mir ezählten, bis es irgendwann aufhörte, dass sie mir etwas erzählten. Aber, sie schrieben auf, was sie entdeckten, Zeichen um Zeichen. Ihre Faszination lies auch die umgebenden Stämme außer Acht, dies es gar nciht gerne sahen, dass wir uns hier aufhielten. In ihren Augen schien diesr Ort verflucht zu sein, keineswegs geeignet, hier zu leben, keineswegs geeignet, einen Jungen meines Alters hier aufwachsen zu lassen. Des Öfteren kamen sie orbei und versuchten uns zu vertreiben. An verschiedenen Tageszeiten versuchten sie es, die Nächte waren die schlimmsten. Ich war immer der Erste, der sie sah, wenn sie kamen. Ich rannte zu meinen Eltern und warnte sie. Ich musste mehrmals an ihren Röcken ziehen, bis sie mir endlich Gehör schenkten. Wir flüchteten dann meist in eine der Höhlen, die tiefer in den Felsen reichten. Dort trauten sich die Stämme selten hinein. Wir verharrten dann bis zum nächsten Tag und warteten einige Stunden, bis wir sicher waren, dass uns keiner mehr etwas antun konnte. Währenddessen, gaben sie mir den Auftrag Wache zu halten, während sie weiter an ihren Büchernund Zetteln schrieben. Sie meinten immer nur es sei das wichtigste auf Erden, es liese keine Pause zu.
Die letzte Nacht in der ein Stamm kam um uns zu verjagen, habe ich in Erinnerung wie nichts anders aus meinem Leben. Man hörte sie schon von Weitem, es waren viele, sehr viele, mehr als es sonst gewesen ist. Wie gewöhnlich warnte ich meine Eltern und es dauerte wie immer, bis ich sie dazu bringen konnte ihre Sachen zu packen und ins Innere der Berges zu fliehen. In dieser Nacht war es zu spät. Sie ahtten schon all ihre Aufzeichnungen in Sicherheit gebracht und es fehlte nur mehr, die Fackeln zu löschen um den Weg hinter uns unsichtbar zu machen. Aufgrund der Eile entschieden sie sich, gemeinsam zu gehen. Sie kamen nie wieder.
Nun bin ich hier schon einige Tage auf Fortunada. Fortunada, Insel der Vergessenen. Fortunada, die Insel im Nirgendwo. Fortunada, die Insel der 72 Jungfrauen. Das waren die letzten Worte, die meine Eltern in ihren Aufzeichnungen niederschrieben. Die Insel der 72 Jungfrauen. Nach dem Begräbnis machte ich mich sofort auf den Weg, etwa ein Jahr dauerte meine Reise. Die Reise war beschwerlich. Bei sengender Hitze durch die Wüste, wenig Wasser. Gefolgt von sengender Hitze auf See ohne jeglicher Brise Wind, die neben einer höheren Geschwindigkeit auch ein wenig Abkühlung hätte bringen können. Dennoch, ich hatte Zeit genug, die Aufzeichnungen meiner Eltern gut zu studieren. Ein Wort, Forunada, reichte nicht um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Ich musste alles zuerst einmal ordnen, was ansich schon nicht leicht war. Man merkte es dem Geschreibsel an, dass meine Eltern im Orient unter großem Druck standen. Und immer hatte ich das Gefühl, dass ich beobachtet wurde. Seit dem Tod meiner Eltern hatte ich immerzu das Gefühl etwas im Nacken zu spüren, kalt, unsichtbar. Aber nichts passierte. Vielleicht sollte auch nichts passieren. Oder ich hatte einfach nur Glück. Nun saß ich da in dieser Spelunke, wenige Leute hatten sich hierher verirrt. Zwei andere Gestalten saßen etwas weiter weg von mir. Sie unterhielten sich, schienen vom Rum schon etwas zu viel genossen zu haben. Stunden schon starrte ich auf das Medaillon meiner Mutter. Gleich würde sich zeigen, ob meiner Eltern Vermächtnis, meiner Eltern jahrelanger Suche nach dem Paradies, der Wahrheit entsprach. Dieses Medaillon. Es war nicht nur ein Familienwappen, es war nicht nur ein Wegweiser zum Ursprung der Teniter. Es war ein Schlüssel, zum Ursprung der Teniter.
Die Tür sprang auf, aber niemand trat ein. Stattdessen, zwengte sich ein kleiner Kopf durch den Spalt und sah mich geradewegs an. Diese Person, ihr Name war Jahon, war einer dieser Einwohner, welche schon seit Generationen auf der Insel lebten. Wie sie hierher kamen, konnte ich nicht herausfinden. Jahon erzählte nicht viel und ich denke, dass wollte er auch nicht. Was mich aber noch mehr verwunderte, war die Ähnlichkeit zu meiner Mutter, zumindest der Gestalt nach. Er wäre unter den Tenitern nicht aufgefallen und hätte durchaus als Teniter gelten können. Ich hatte ihm am ersten Tag meiner Ankunft kennen gelernt. Nach dem Anlegen, genehmigte ich mir eine Pause und versuchte mich wieder an festen Boden unter meinen Füßen zu gewöhnen. Hernach, streunte ich durch die wenigen Häuser und zeigte einigen Bewohnern das Medaillon. Keiner erkannte es und ich war schon fast am verzweifeln. Ich setzte mich auf eine Bank und schaute auf das Meer, in Gedanken, ob ich jemals das zu Ende bringen konnte, was mir meine Eltern hinterliesen. Das setzte er sich neben mich, ganz unscheinbar. Er beobachtete mich schon den ganzen Tag und fragte mich, ob ich mehr darüber erfahren wollte. Ich sagte ja und er bedeutete mir, ihm zu folgen. Wir gingen zu seinem Haus treten ein und ich folgte ihm in eine Art Kartenraum. Er meinte, er habe einige von den Seefahrern bekommen, mache habe er ihnen abgekauft. Manche aber bekam er von seinem Vater. Er suchte und zog eine alte Rolle aus dem Regal, legte sie auf den Tisch und breitete sie vor mir aus. Was ich vor mir sah, lies mir buchstäblich das Blut in den Adern gefrieren. Ich begann zu zittern, Gänsehaut zog sich langsam über meinen ganzen Körper. So als wisse er wie es mir ginge, schob er hinter mir einen Stuhl hin und ich setzte mich. Es bedurfte eigentlich keinem Reden mehr, aber wir verbachten den ganzen restlichen Tag und die darauffolgende Nacht und sprachen.
Nun stand er in der Tür und nickte leicht. Die anderen Gäste bemerkten Jahon, wendeten sich aber gleich wieder ab und beschäftigten sich wieder mit dem was sie vorher taten. Ich stand auf und folgte ihm nach draussen. Bewaffnet mit einer Fackel in der Hand machten wir uns auf den Weg nach Norden. Dorthin wo die Strahlen der Sonne begannen. Der Marsch war beschwerlich, wir mussten den Berg umrunden. Mit dem Boot schien es um diese Uhrzeit zu gefährlich, also gingen wir. Am Horizont begann sich schon die Sonne zu zeigen und tauchte alles was ich vor mir sah in warmes dunkeloranges Licht. Die Spiegelungen auf dem Wasser blendeten mich so sehr, dass ich als wir ankamen erst nicht erkannte, was sich vor mir befand. Ich legte meine rechte Hand über die Augen und drehte den Kopf ein wenig um mich vor der Sonne zu schützen. Lieber wäre ich geblendet geblieben, denn als sich meine Augen an den neuen Lichteinfall gewohnt hatten, blieb mir regelrechtg das Herz stehen. Ich atmete schwer und war starr vor Überraschung. Es hatte einen Grund, warum Johan mich um genau diese Zeit hierher führte. Die Ebbe hatte eingesetzt. Das zurückgezogene Wasser gab nun mehr vom Meeresboden frei und das was es frei gab, waren acht etwa in einem Winkel von 45 Grad nebeneinanderliegende längliche Steinformationen. Sie waren dem Lebensraum angepasst, einige Korallen klebten darauf und liesen diese Felsen recht unscheinbar wirken. Zumindest für jeden der das Medallon nicht kannte. Hinter jedem Felsen ragten je neun Spitzen empor, die wie Termitenhügel oder Magmageysire ausssahen. Sie standen näher zusammen als es auf dem Medaillon der Fall war, aber die Ähnlichkeit war unverwechselbar. Die Zeit in der ich diesem Muster folgte schien mir wie eine Ewigkeit vorzukommen und mein Herzschlag hatte sich immer noch nicht wieder beruhigt. Den krönenden Abschluß am Ende dieser Spitzen war ein Steinbogen, der, wenn man genau hinsah, behauen sein musste. Aufgrund der Ablagerungen, die sich im Laufe der Jahrhunderte bildeten, konnte man es nicht ganz so erkennen. Der Bogen war sehr regelmäßig hatte auf der Vorderseite einige Symbole eingraviert. Ich konnte sie nicht richtig erkennen, denn ich wurde die ganze Zeit vom Inneren des Bogens abgelenkt. Das Innere des Bogen war, wie man sich denken konnte, ein Halbkreis, mit einem Radius, etwa das zweifache meiner Körpergröße. Es war noch früh am Morgen und die Luft war frisch und klar, aber im Inneren des Bogens wabberte die Luft. Sie pulsierte. Ein blaugrüner Schimmer mit roten Akzenten am Rand legte sich über das Pulsieren, ruhig und angenehm. Wenn ich mich darauf konzentrierte, merkte ich, dass sich mein Puls zu beruhigen begann. In mir breitete sich Stille aus und ich blendete Stück für Stück meine Umgebung aus. Jahon stand rechts vor mir und deutete ins Zentrum des Bogens. Aber je länger ich stand und mich auf das große Medaillon konzentrierte, mit dem ruhigen und angenehmen Pulsieren, desto weniger verstand ich und desto weniger nahm ich auch wahr. Jahon sprach auch zu mir, ich konnte erst nicht verstehen, aber ich versuchte mich zu konzentrieren und hörte: Du musst hinein gehen, Du musst hindurch gehen. Deine Eltern sind dort. Du wirst sie wieder sehen. Und ich ging.